Der wirtschaftliche Aufschwung als Folge der industriellen Revolution führte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Erstarken des bürgerlichen Liberalismus in Deutschland. Nach und nach wich die Reaktionspolitik der 1850er Jahre neuen Reformbestrebungen in allen Bereichen des bürgerlichen Lebens. Unter diesem Eindruck war auch 1861 der bayerische Lehrerverein gegründet worden, der eine allgemeine Verbesserung der Lebenssituation der Lehrer herbeiführen und eine Lockerung der staatlichen Repressalien erwirken wollte. Fanden diese Bestrebungen im liberalen Bürgertum breite Zustimmung, so sprachen sich konservative Kreise extrem dagegen aus. Besonders die konservative Presse bombardierte die Lehrerschaft geradezu mit Beschimpfungen.
So behauptete das „Korrespondenzblatt für innere Mission“ in Neuendettelsau 1865: „Seit man den Lehrern Wohnungen gibt, die sie nicht zu möbilieren vermögen; seit man ihnen Kreise anweist, in denen sie sich weder innerlich noch äußerlich zu bewegen verstehen, seitdem sind diese gespreizten Halbwisser zu Karikaturen geworden, die um so lächerlicher werden, je mehr sie sich über das Lächeln anderer erbosen.“
Das „Augsburger Wochenblatt für den christlichen Verein“ wies auf die naturgemäß niedere und beschränkte Berufstätigkeit der Lehrer hin und glaubte, sie durch Weber, Hirten oder Schneider ersetzen zu können. Das „evangelische Schulblatt“ sprach den Mitgliedern des Lehrervereins Mannesehre, Lehrertreue und Christenpflicht ab und verwies die Lehrer bei ihren Forderungen nach besserer Besoldung auf die Hilfe Gottes.
Die „Pfälzer Post“ schrieb 1879: „Was sollen wir zu jenen verkrüppelten, ungeheuerlichen Gestalten sagen, die jetzt so manchmal unter uns herumwandeln, mit hochmütig verächtlichen Mienen und geschwollenen Wesen, als hätten sie die Welt geschaffen. (...) So ein liberales Schulmeisterlein ist mitunter gar ungeheuer naseweis und frech und glaubt, weiß der Himmel welch großer Gelehrter zu sein, wenn er vor den Schulkindern das kirchliche Dogma für Dummheit erklärt, über die Jesuiten schimpft, den Bismarck verhimmelt oder gar die Bibel korrigiert.“ Bezeichnungen wie „liberale Kirchturmköpfe“, „ABC-Professoren“, „nichts lernendes und nichts vergessendes Schulmeisterlein“ oder „dünkelhafte Kirchenfeinde“ waren an der Tagesordnung.
Das 1866 gegründete „Vereinsblatt des Lehrervereins“ bzw. die „Bayerische Lehrer-Zeitung. Organ des bayer. Volksschullehrer-Vereines“ (ab 1867) geriet mit den Kernthemen Bildung, Besoldung, Aufsicht und Freiheit in den Fokus der konservativ-reaktionären Presse und wurde, vor allem in den Jahren von 1880 bis 1900, das Ziel heftiger Attacken.

„Der Beobachter am Main“ schrieb 1893: „'Die Bayerische Lehrerzeitung' hat sich absolut unfähig gezeigt, auch nur eine einzige schulpolitische Frage in objektiv sachlicher Weise zu behandeln. (…) Wo sie Widerstand begegnet, dort scheut sie niemals zurück, in bornierter-gehässiger Weise kirchliche Einrichtungen und Organe zu bekämpfen und die religiöse Überzeugung gläubiger Christen und namentlich von uns Katholiken aufs tiefste zu verletzen.“
Im gleichen Jahr schrieb die „Augsburger Postzeitung“: „Das liberale Lehrertum feiert fortwährend wahre Orgien der Intoleranz und des Fanatismus. Das 'parteilose' Organ des Bayerischen Lehrervereins scheint zur Zeit seine einzige Aufgabe in dem Kampfe gegen den 'Ultramontanismus und ähnliche Richtungen' zu erblicken.“
Die konservativen Kräfte waren aber stark genug, für lange Zeit eine Besserstellung des Lehrerstandes zu verhindern. Noch 1900 erhielt ein Lehrer im Bamberger Raum etwa 800 Mark im Jahr. „Trostlos“ lautete der Kommentar der „Münchner Neuesten Nachrichten“: „In diesem Jahr kostet ein Wintermantel zwischen 12 und 45 Mark, ein Päckchen Zwieback zwei Mark, ein Kilogramm Butter 1,40 Mark, ein Maß Bier 26 Pfennig.“
Sogar Prinzregent Luitpold meinte 1905 bei einem Besuch des Freisinger Lehrerseminars zum dortigen Direktor: „Machen Sie meine Lehrer nicht zu gescheit“, und gab damit der Festgefahrenheit des alten Lehrerbildes Ausdruck.
Erst mit dem Einzug der Demokratie in Deutschland im Jahr 1919, der Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht und der Anerkennung der Lehrer als reguläre Beamte mit entsprechender Besoldung begannen für die Lehrerschaft in Bayern und auch in den anderen Ländern Deutschlands bessere Zeiten.
Bleibt noch anzumerken, dass, unabhängig von den üblen Attacken konservativ-ultramontaner Gruppierungen gegen den Lehrerstand, im 19. Jahrhundert viele Lehrer in ihrem Wirkungskreis hohes Ansehen genossen und mit den verschiedensten Ehrungen ausgezeichnet wurden. Vor allem auf dem Land waren Lehrer, oft auch in Ehrenämtern usw., Impulsgeber für die wirtschaftliche und kulturelle Weiterentwicklung der Dörfer.
Mit sechs Themenkreisen und in Verbindung mit entsprechenden Exponaten in der ständigen Ausstellung des Schulmuseums ermöglicht die Sonderausstellung vielseitige Einblicke in die damalige Lebenswelt der Lehrer. (
Bert und Eduard Stenger)
Information: 9. September bis 12. November. Schulmuseum der Stadt Lohr a. Main, Sendelbacher Straße 21, 97816 Lohr a. Main. Mi. bis So./Fei. 14 bis 16 Uhr.










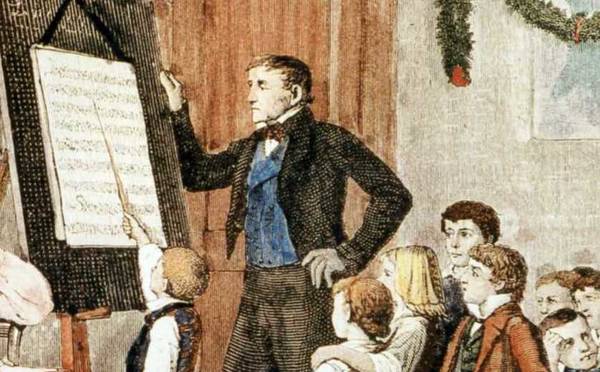
 „Der Beobachter am Main“ schrieb 1893: „'Die Bayerische Lehrerzeitung' hat sich absolut unfähig gezeigt, auch nur eine einzige schulpolitische Frage in objektiv sachlicher Weise zu behandeln. (…) Wo sie Widerstand begegnet, dort scheut sie niemals zurück, in bornierter-gehässiger Weise kirchliche Einrichtungen und Organe zu bekämpfen und die religiöse Überzeugung gläubiger Christen und namentlich von uns Katholiken aufs tiefste zu verletzen.“
Im gleichen Jahr schrieb die „Augsburger Postzeitung“: „Das liberale Lehrertum feiert fortwährend wahre Orgien der Intoleranz und des Fanatismus. Das 'parteilose' Organ des Bayerischen Lehrervereins scheint zur Zeit seine einzige Aufgabe in dem Kampfe gegen den 'Ultramontanismus und ähnliche Richtungen' zu erblicken.“
Die konservativen Kräfte waren aber stark genug, für lange Zeit eine Besserstellung des Lehrerstandes zu verhindern. Noch 1900 erhielt ein Lehrer im Bamberger Raum etwa 800 Mark im Jahr. „Trostlos“ lautete der Kommentar der „Münchner Neuesten Nachrichten“: „In diesem Jahr kostet ein Wintermantel zwischen 12 und 45 Mark, ein Päckchen Zwieback zwei Mark, ein Kilogramm Butter 1,40 Mark, ein Maß Bier 26 Pfennig.“
Sogar Prinzregent Luitpold meinte 1905 bei einem Besuch des Freisinger Lehrerseminars zum dortigen Direktor: „Machen Sie meine Lehrer nicht zu gescheit“, und gab damit der Festgefahrenheit des alten Lehrerbildes Ausdruck.
Erst mit dem Einzug der Demokratie in Deutschland im Jahr 1919, der Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht und der Anerkennung der Lehrer als reguläre Beamte mit entsprechender Besoldung begannen für die Lehrerschaft in Bayern und auch in den anderen Ländern Deutschlands bessere Zeiten.
Bleibt noch anzumerken, dass, unabhängig von den üblen Attacken konservativ-ultramontaner Gruppierungen gegen den Lehrerstand, im 19. Jahrhundert viele Lehrer in ihrem Wirkungskreis hohes Ansehen genossen und mit den verschiedensten Ehrungen ausgezeichnet wurden. Vor allem auf dem Land waren Lehrer, oft auch in Ehrenämtern usw., Impulsgeber für die wirtschaftliche und kulturelle Weiterentwicklung der Dörfer.
Mit sechs Themenkreisen und in Verbindung mit entsprechenden Exponaten in der ständigen Ausstellung des Schulmuseums ermöglicht die Sonderausstellung vielseitige Einblicke in die damalige Lebenswelt der Lehrer. (Bert und Eduard Stenger)
Information: 9. September bis 12. November. Schulmuseum der Stadt Lohr a. Main, Sendelbacher Straße 21, 97816 Lohr a. Main. Mi. bis So./Fei. 14 bis 16 Uhr.
„Der Beobachter am Main“ schrieb 1893: „'Die Bayerische Lehrerzeitung' hat sich absolut unfähig gezeigt, auch nur eine einzige schulpolitische Frage in objektiv sachlicher Weise zu behandeln. (…) Wo sie Widerstand begegnet, dort scheut sie niemals zurück, in bornierter-gehässiger Weise kirchliche Einrichtungen und Organe zu bekämpfen und die religiöse Überzeugung gläubiger Christen und namentlich von uns Katholiken aufs tiefste zu verletzen.“
Im gleichen Jahr schrieb die „Augsburger Postzeitung“: „Das liberale Lehrertum feiert fortwährend wahre Orgien der Intoleranz und des Fanatismus. Das 'parteilose' Organ des Bayerischen Lehrervereins scheint zur Zeit seine einzige Aufgabe in dem Kampfe gegen den 'Ultramontanismus und ähnliche Richtungen' zu erblicken.“
Die konservativen Kräfte waren aber stark genug, für lange Zeit eine Besserstellung des Lehrerstandes zu verhindern. Noch 1900 erhielt ein Lehrer im Bamberger Raum etwa 800 Mark im Jahr. „Trostlos“ lautete der Kommentar der „Münchner Neuesten Nachrichten“: „In diesem Jahr kostet ein Wintermantel zwischen 12 und 45 Mark, ein Päckchen Zwieback zwei Mark, ein Kilogramm Butter 1,40 Mark, ein Maß Bier 26 Pfennig.“
Sogar Prinzregent Luitpold meinte 1905 bei einem Besuch des Freisinger Lehrerseminars zum dortigen Direktor: „Machen Sie meine Lehrer nicht zu gescheit“, und gab damit der Festgefahrenheit des alten Lehrerbildes Ausdruck.
Erst mit dem Einzug der Demokratie in Deutschland im Jahr 1919, der Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht und der Anerkennung der Lehrer als reguläre Beamte mit entsprechender Besoldung begannen für die Lehrerschaft in Bayern und auch in den anderen Ländern Deutschlands bessere Zeiten.
Bleibt noch anzumerken, dass, unabhängig von den üblen Attacken konservativ-ultramontaner Gruppierungen gegen den Lehrerstand, im 19. Jahrhundert viele Lehrer in ihrem Wirkungskreis hohes Ansehen genossen und mit den verschiedensten Ehrungen ausgezeichnet wurden. Vor allem auf dem Land waren Lehrer, oft auch in Ehrenämtern usw., Impulsgeber für die wirtschaftliche und kulturelle Weiterentwicklung der Dörfer.
Mit sechs Themenkreisen und in Verbindung mit entsprechenden Exponaten in der ständigen Ausstellung des Schulmuseums ermöglicht die Sonderausstellung vielseitige Einblicke in die damalige Lebenswelt der Lehrer. (Bert und Eduard Stenger)
Information: 9. September bis 12. November. Schulmuseum der Stadt Lohr a. Main, Sendelbacher Straße 21, 97816 Lohr a. Main. Mi. bis So./Fei. 14 bis 16 Uhr.





Kommentare (0)
Es sind noch keine Kommentare vorhanden!