 Er hat schon viel erlebt. Karl Stankiewitz ist 1928 geboren und einer der ältesten aktiven Journalisten in Deutschland. Doch die Corona-Krise stellt auch den Münchner Autor vor viele neue Herausforderungen. Sein Corona-Tagebuch, das auf bayerische-staatszeitung.de regelmäßig aktualisiert wird, gibt spannende Einblicke in das Leben in München während der Corona-Krise - aus ganz persönlicher Sicht.
Er hat schon viel erlebt. Karl Stankiewitz ist 1928 geboren und einer der ältesten aktiven Journalisten in Deutschland. Doch die Corona-Krise stellt auch den Münchner Autor vor viele neue Herausforderungen. Sein Corona-Tagebuch, das auf bayerische-staatszeitung.de regelmäßig aktualisiert wird, gibt spannende Einblicke in das Leben in München während der Corona-Krise - aus ganz persönlicher Sicht.
28. Juni 2021 (Ende)
Wer die Krise der vergangenen zwanzig Monate bilanzieren will, dem stellt sich auch die Frage, welche Veränderungen an seiner Denk-, Lebens- und Arbeitsweise er selbst erkennen kann, mutmaßlich hervorgerufen oder doch verstärkt durch das lange Eingesperrtsein und andere Zwänge des Lockdowns. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, inwieweit Corona die Gesellschaft allgemein, soweit örtlich überschaubar, beeinflusst hat. Denn die mittel- und langfristigen Folgen sind noch längst nicht abzusehen. Zwar liegen dazu seit Längerem detaillierte Studien zahlreicher „Experten“ vor, die meisten aber bewegen sich im Bereich der Spekulation.
Es kann daher nur ein individueller Versuch sein, Soll und Haben auf die Reihe zu bringen. So könnten als positiv erscheinen: eine Zunahme an Disziplin, Toleranz, Solidarität, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, wie ich sie schon zu Anfang dieses Tagebuchs notieren konnte. Zu bemerken sind auch eine Neuentdeckung der Nähe, der Natur, des Landlebens, die Anerkennung des Verzichts (insbesondere bei Heranwachsenden), das Verlangen nach voller Gleichberechtigung (etwa der Geschlechter), nach mehr Ruhe und Langsamkeit: ein Schuhgeschäft in der Theatinerstraße plakatiert im Schaufenster: „Walk, don’t run.“ (Anscheinend hat die schöne deutsche Sprache in der Produkt- und Kulturwerbung vollends ausgespielt).
Womit wir gewissermaßen bei den negativen Veränderungen durch die „Krise als Challenge“ wären. „Upskilling“ nennt die Psychoanalyse den Erwerb und die Verfestigung neuer Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Denkansätze. Und die können auch auf der Soll-Seite einer Corona-Bilanz verbucht werden. Auffallend ist jedenfalls, wie die Spätphase der Pandemie dunkle Erscheinungen wie Intoleranz, Abneigung von Wissenschaft und Ratio (Querdenker), Hass, Rassismus, Antisemitismus und, ja auch das, Gewaltbereitschaft nicht nur an Rändern der Gesellschaft verstärkt hat. Sie suchen geradezu die Öffentlichkeit.
Dies alles hängt natürlich ab von Anlage und Erziehung, mehr noch der Lebens- und Berufserfahrung, mithin vom Alter. Fast sicher ist, dass diese wie auch die positiven Veränderungen in der Solidargemeinschaft längst schon als Trends in der Luft lagen; die Umstände haben sie wohl nur noch fortgeführt, verstärkt, selbstverständlich gemacht. Und so stimmt es denn wohl, was mir meine Nichte Elsa einmal aus Mexiko gemailt hat: „Corona bringt das Beste und das Schlechteste des Menschen zutage.“
Zum Schluss kein Happy End - leider
Eigentlich wollte ich noch weitere Beispiele für die vielleicht anhaltenden Folgen der Pandemie hinzufügen, bevor ich dieses Tagebuch schließe. Und eigentlich wollte ich mit Freunden eine Kajaktour im Bayerischen Wald unternehmen. Aber dann ist alles anders gekommen. Jetzt liege ich im Krankenhaus. In Lenggries bin ich über eine banale Stufe gestürzt. Nichts Besonderes für einen 92-Jährigen mit Sehschwäche. Während meine Enkeltochter am Fuß des Brauneck mit dem Gleitschirm landete, landete ich im Klinikum München Rechts der Isar.
Da erwachen Erinnerungen. Vor über 50 Jahren lag ich hier in einer alten Kriegsbaracke. Ein gewagter Skisprung brachte mir einen Drehbruch des Schienbeins ein. Chefchirurg Professor Simon Snobkowski, später Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Bayerns, schoss mir einen Bolzen durch die Ferse und legte mich drei Wochen in den Streckverband. Die Zeit nützte ich, indem ich auf meiner alten Olympiaschreibmaschine einen Bericht über das Geschehen tippte.
Später war ich noch öfters als Patient in dieser ehrwürdigen Krankenanstalt, meist nach Sportunfällen. Zuletzt war es eine Oberschenkelhalsfraktur. Seither hat sich hier viel verändert. Wurden man früher am Krankenbett beraten, so muss der Patient jetzt kreuz und quer durch endlose Gänge gehen oder humpeln und stundenlang vor allen möglichen Türen warten und immer wieder seine Unterschrift unter immer gleiche Texte setzen. „Wir sind etwas überbürokratisiert“, meint mein Stationsarzt.
Pausenlos eilen Ärzte, Pfleger und Schwestern durch die Ströme der Besucher und Patienten. Keine Miene, kein Lächeln bei den Weißkitteln hinter der Maske erkennbar. Freundlich, höflich und hilfsbereit sind sie dennoch. Irgendwie scheint Corona die Zwischenmenschlichkeit zu beeinträchtigen. Nicht weniger als 6600 Menschen aus aller Herren Länder sind hier beschäftigt. Eine internationale Gesundheitsfabrik mit wissenschaftlichem Anspruch, die schon während der Cholera-Epidemie im 19. Jahrhundert eine maßgebende Rolle gespielt hat.
Meine Operation verläuft gut, die Schmerzen aber sind heftig und anhaltend. Im Bett neben mir wartet ein junger Mann auf seine Operation. Der 21-jährige Grieche Vladimiros war beim Baden am Riemer See mit zwei Freunden von einer Gruppe angepöbelt und geschlagen worden, erzählt er. Als er sich wehrte, schlug ihm einer der Kerle, die er für junge Türken hielt, mit einer Machete auf den Arm, eine Sehne riss. Alte Rivalität zwischen Griechen und Türken? Vladimiros zuckt die Schultern. Der Polizeibericht bestätigt: „Ein zufällig vorbeikommender Polizist leistete Erste Hilfe und versorgte die Wunde. Der Täter ist flüchtig.“
Krank sein in Corona-Zeiten. Leider muss ich dieses Tagebuch nun mit diesem bitteren Geschichte beenden, statt mit einem Happy End.
Das Tagebuch von Karl Stankiewitz in chronologischer Reihenfolge:
Januar 2020
In der SZ lese ich eine Kurzmeldung, deren Überschrift aus drei Wörtern besteht: „Lungenkrankheit in China“. Corona: Im katholischen Altbayern denkt man dabei vielleicht an die Heilige Corona. Die 16-jährige Christin aus Damaskus, die buchstäblich zerrissen wurde, wird als Schutzherrin gegen Seuchen verehrt. Mehrere Wallfahrtskirchen sind ihr hierzulande geweiht.
Ein 33-jähriger Angestellter der Autozulieferfirma Webasto in Stockdorf bei München hat sich bei einer Schulung bei einer Kollegin aus Shanghai mit SARS-CoV-2 angesteckt. Später wird bei weiteren Angestellten und deren Familienmitgliedern eine Infektion festgestellt. Alle Erkrankten müssen in Quarantäne. Die Firmenzentrale schließt.
Anfang März 2020
Die Hiobsbotschaften überstürzen sich. Mehrere Länder, voran Italien, Israel und die USA, verfügen Reisebeschränkungen. Erste Veranstaltungen werden abgesagt: die wichtige Weltmesse des Tourismus, die ITB in Berlin, die internationale Handwerksmesse in München oder auch das Startbierfest auf dem Münchner Nockherberg. Die Wirte anderer Bierpaläste hingegen schenken ihr Frühjahrsstarkbier weiter aus.
Die Zahl der Infizierten in München klettert auf insgesamt 60 Fälle. Die Staatsregierung beschließt, dass keine Veranstaltungen mehr mit mehr als tausend Teilnehmern stattfinden dürfen. Das trifft vor allem die großen Münchner Theater, die Fußballstadien und etliche Bierhäuser. Nur die Vorbereitungen fürs Oktoberfest laufen vorerst weiter.
11. März 2020
Die Weltgesundheitsorganisation erklärt die neue SARS-Epidemie zur Pandemie, zur weltweiten Seuche. Bayern zählt 558 und München 39 Infizierte. Von nun an trifft es auch Bayern und München Schlag auf Schlag. Erste Schulen schließen. Veranstalter, Reisebüros und Hotels melden Absagen. Personal wird gekündigt oder in Kurzarbeit geschickt, Angestellte wechseln ins Home-Office.
15. März 2020
Ein sonniger Sonntag. Kommunalwahlen in Bayern. Frühmorgens ist das Wahlzimmer in der Kerschensteiner Schule noch leer. Alle Wahlhelfer tragen Handschuhe. Ein Wasserbecken mit Seife und Handtuch steht für die Wähler bereit. Für einige der 775 Münchner Wahllokale mussten am Abend zuvor noch Lehrer gewonnen werden, weil ein Viertel der Wahlhelfer aus Vorsicht abgesagt hat. Man sieht auch Mundschutz; eine Maske mit langem Schnabel gleicht, wie ein Zeitungsbild zeigt - ähnlich der grausigen Pestmasken des Mittelalters.
Corona zum Trotz fahren wir nach der Wahl hinaus ins Oberland. Die Züge der BOB nach Bad Tölz sind gut besetzt, noch ist der Eisenbahnverkehr nicht eingeschränkt. Und die besonnten Vorplätze der Cafés am Isarskai bersten schon am Vormittag von Besuchern. Jemand zitiert Goethe: „Aus dem hohlen, finstern Tor drängt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heut so gern...“ Man könnte bei Spaziergang allerdings auch an eine andere Faust-Szene denken: „Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er es am Kragen hätte ,..“
Das teuflische Virus hat bis zu diesem schönen Sonntag in Bayern bereits über tausend Menschen gepackt. Aus Würzburg wird der dritte Todesfall aus einem Seniorenheim gemeldet.
16. März 2020
Für Bayern gilt der Katastrophenfall. Am Nachmittag folgen die anderen deutschen Landesregierungen an. Konkret bedeutet das die sofortige und unbefristete Schließung aller Freizeitstätten wie Schwimmbäder, Kinos oder Clubs. Die christlichen Kirchen haben schon von sich aus ihre Gottesdienste eingestellt. Man erwägt, dies verpflichtend allen Religionsgemeinschaften vorzuschreiben. Der Dom ist dennoch gut besucht. Viele Münchner beten und bitten, das Unheil abzuwenden. Überall brennen Kerzen in der Dunkelheit.
In meinem Altstadtviertel Lehel scheint das gewohnte Gewimmel an diesem Werktag deutlich nachgelassen zu haben. Immerhin sind ja alle Schulen und Kitas schon seit Freitag geschlossen. Am Eingang meiner Bank hängt ein Zettel mit einem rührenden Angebot von Schülern, die anbieten, Mitbürgern bei Einkäufen zu helfen.
Auch jedem zweiten Tisch meines Stammlokals liegt ein Zettel. Jeder Tisch soll aus hygienischen Gründen frei bleiben. Abgesehen von einem Pärchen bin ich der einzige Mittagsgast in dem großen Restaurant. Die junge Kellnerin ist noch eine Spur aufmerksamer als sonst, sie bittet zum Händewaschen an die Theke („Da müssen Sie nicht extra in die Toilette gehen“) und reicht ein Fläschchen zum Desinfizieren.
Per Rundfunk und Computer werde ich den ganzen Tag über von Negativmeldungen heimgesucht. Ununterbrochen hagelt es Absagen von allerlei Veranstaltungen - auch meine eigene Lesung aus meinem Buch „Münchner Meilensteine“ entfällt. Eine E-Mail spuckt Verhaltensregeln aus. „Das Virus ist nicht hitzebeständig, trinken Sie viel heißes Wasser“, so der Tipp angeblich von einem in China forschenden italienischen Arzt. Ich leite sie zur Information weiter, muss aber bald erfahren, dass es sich um eine von vielen Fake News handle. Allerlei Gauner sind bereits in Sachen Corona auf Dummenfang.
17. März 2020
Eigentlich wollte ich mir Sigmar Gabriel anhören. „Mehr Mut“ heißt das Buch, über das der manchmal krisengeschüttelte SPD-Politiker im Café Luitpold reden wollte. Die Diskussion ist natürlich auch gestrichen. Doch viel mehr als die Politiker sind die vielen Künstler von der verordneten Kulturpause betroffen. „Das Geldverdienen wird sich wohl in der Zukunft für Jungs wie mich anders gestalten müssen“, schreibt mir mein Freund, der Isar-Indianer Willy Michl. Trotzdem schreckt ihn der „Supergau“ wenig. „Ich hab was zu bieten, und die Zwischenphase werd ich auch übersteh‘n, man muss immer guter Dinge sein.“
Etwas weniger gelassen gibt sich ein anderer Freund, Dietmar Holzapfel – obwohl er, „Münchens Regenbogen-Regent“, schon während der als „Schwulenseuche“ verschrienen AIDS-Epidemie ähnliche Eingriffe ins Private erlebt hat. Dass er sein Restaurant Deutsche Eiche jetzt sofort zugesperrt hat, macht ihn nicht ganz so „sehr traurig“ wie das Verbot, seine Mutter im Altersheim zu besuchen. „Wenn das Ende kommt und kein Verwandter ist dabei, möchte man so von der Welt gehen?“
Auch meine eigene Enkeltochter Tania will mich bis auf weiteres nicht mehr besuchen. Als Flugbegleiterin der Lufthansa, die 700 ihrer 723 Maschinen am Boden hält, hatte sie Kontakt mit vielen Ausländern, jetzt hätte sie viel freie Zeit.
18. März 2020
Jetzt leeren sich die auch die zuvor noch vollen Biergärten sowie die Straßen zusehends. Wenige Passanten, offensichtlich Touristen aus Asien, tragen eine Binde vor Mund und Nase. Am Viktualienmarkt ist Ausverkauf angesagt. Auf Fischgerichte beispielsweise gibt es 60 Prozent Rabatt. Das weltweit berühmte Hofbräuhaus hat bereits geschlossen; einige Traditionshäuser folgen ihm bald, obwohl sie ja bis 15 Uhr offenhalten dürften. Der Augustinerwirt schätzt, dass in den nächsten Tagen etwa 80 Prozent aller Gaststätten in der Altstadt zumachen. Es lohnt einfach nicht mehr, zumal höchstens noch 30 Gäste gleichzeitig mit je 1,5 Meter Abstand bewirtet werden dürfen.
Auch die Mehrzahl der kleinen Händler will die Rollos runterlassen. Einige hoffen, durch Online-Verkauf oder Kurzarbeit über die Krise zu kommen. Andere verlangen Kreditkarten statt Bargeld. Die Münchnerinnen und Münchner kaufen ein wie wild auf Vorrat.
Mich erinnert dieser Kaufzwang an eine noch schlimmere Zeit. Im Herbst 1946, als München hungerte, hatte mich die Mutter öfter mitgenommen zum „hamstern“. Mit einem Löffel in der Hand hatten wir Bauernhöfe in der Umgebung abgeklappert, waren froh und dankbar für einen Batzen Butter oder eine Tüte Mehl. Bieten konnten wir für solch kleine Spenden nichts. Andere brachten Teppiche oder Silberteller mit aufs Land.
Desinfektionsmittel werden rar. Ein Apotheker mixt sie selber. Kein Engpass, alles vorrätig, versichert dagegen meine Apothekerin. Freundlicher als gewohnt reicht sie mir als einzigem Kunden die verordneten Medikamente unter einer nagelneuen Wand aus Kunstglas durch.
19. März 2020
In Großhadern ringt einer der ersten Viruspatienten schon seit 29. Februar mit dem Leben; der 65-Jährige wurde beim Skifahren in Ischgl angesteckt. Auch drei Ärzte, sechs Schwestern und ein Medizinstudent wurden bereits infiziert.
Im Übrigen geht der ärztliche Dienst in der Stadt offenbar seinen gewohnten Gang. Ich erfahre, dass meine für morgen terminierte Augenoperation keineswegs abgesagt ist. Seit Tagen leistet ein großer Teil des medizinischen Personals freiwillige Überstunden. Viele Ärzte stellen sich zum Testen bei Verdachtsfällen zur Verfügung, da die beiden vom Gesundheitsamt eingerichteten Drive-in-Teststationen bereits überlaufen sind. Karl Steffen Gerhard zum Beispiel hat den Kleinbus, mit dem er sonst in Urlaub fährt, vor seine Praxis geparkt, um darin Abstriche anzubieten. Das hat den Vorteil, dass die Testperson gar nicht erst ein Wartezimmer betreten muss und eventuelle Viren an andere Patienten weitergibt.
Vor einem Weingeschäft im Lehel steht ein Rudel nicht mal ganz junger Frauen und Männer unter der Mittagssonne, ziemlich fröhlich wie in Party-Stimmung und ziemlich nah zusammen. „Social Distancing“ scheint ihnen unbekannt zu sein. Mein Begleiter meint, das müsse doch nicht sein. Der immer gut aufgelegte Kellner vom nahen Esslokal ruft einer jungen Frau zu, sie möge nicht so nahe herankommen, „wegen Ebola“. Es soll wohl ein Witz sein. Später, in einer Fernsehrunde, kursiert das Söder-Wort „Charaktertest“.
Um dem "Lagerkoller" vorzubeugen, der mit dem Home-Office befürchtet wird, lassen sich die Medien allerlei einfallen. Die Abendzeitung bringt Tipps für das ungewohnte Leben „dahoam“, die aber, obwohl von Promis unterfüttert, nicht viel mehr bieten als Kartenspiele und Kreuzworträtsel. Der Münchner Merkur legt nach mit König-Ludwig-Fragen und Kochrezepten zur Immunstärkung. Sinnvoller erscheinen mir die von der Süddeutschen Zeitung aufgelisteten Kultur-Darbietungen, die über verschiedene Streaming-Kanäle laufen, und die neue Kolumne „Alles zu, Zeitung auf“. Sie will die zuhause bleibenden Kinder täglich mit Rätseln, einem Witze-Duell und sonstigen Krimskrams unterhalten
In Deutschland gibt es nun 10 999 Virus-Träger, wobei mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet wird.
20. März 2020
Der Präsident des tonangebenden Robert-Koch-Instituts sagt nüchtern voraus: „Die Zahl der Toten wird weiter steigen.“ Dieser Tage erst sind drei meiner Freunde gestorben, wenn auch nicht wegen irgendwelcher Viren. Der Horst in Berlin, der Franz in Bad Feilnbach und der Oskar in München. In solchen Stunden, da der Tod plötzlich aus dem Hintergrund hervortritt, macht man sich seine Gedanken. Mit meinen 91 Lebensjahren, hohem Bluthochdruck und Vorerkrankung gehöre ich ja zur Hochrisikogruppe. Unwillkürlich klicke ich den Sound-Titel „Mein Testament“ und höre das wunderbare Lied von Reinhard Mey mit dem tröstlichen Schluss: „Dieser ist mein letzter Wille, doch ich hoffe sehr dabei, dass der Wille, den ich schreibe, doch noch nicht der letzte sei...“ Indes, die Epidemie trifft sogar die Toten. Auf Münchens Friedhöfen sind Umarmen, Weihwasser und das Werfen von Erde ausdrücklich verboten. Empfohlen wird „online kondolieren“.
Heute ist übrigens der „Welttag des Glücks“. Außerdem wäre der 200. Geburtstag von Friedrich Hölderlin zu feiern. Da passt es doch gut, dass Buchhändler, die nur noch online verkaufen, das aufmunternde Dichterwort plakatieren: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“
Die Gefahr ist überall. Kein Wunder, dass das Straßenbild jetzt deutlich ausgedünnt ist. Wenig Autos, wenig Radler, noch weniger Passanten. Und auch weniger Patienten als sonst in der Augenklinik. „Das  Angstniveau ist unterschiedlich,“ begründet der Anästhesist die Terminabsagen. Mein Makula-Eingriff verläuft schnell und problemlos. „Scheißgeschäft,“ schimpft dann der Taxifahrer, der mich auf den Hintersitz platziert. Sein Gewerbe wurde auf vier Standorte in der Stadt reduziert.
Angstniveau ist unterschiedlich,“ begründet der Anästhesist die Terminabsagen. Mein Makula-Eingriff verläuft schnell und problemlos. „Scheißgeschäft,“ schimpft dann der Taxifahrer, der mich auf den Hintersitz platziert. Sein Gewerbe wurde auf vier Standorte in der Stadt reduziert.
Und wieder prescht Bayern im Corona-Krieg vor. „Wir sperren nicht das Land zu, aber wir fahren das öffentliche Leben völlig herunter,“ erläutert Krisen-Kommandant Söder. Das heißt: Verlassen der Wohnung nur noch bei Vorliegen „triftiger Gründe“, nur alleine oder in Begleitung von Personen aus dem eigenen Haushalt.
Ich lasse mir von Meister Martin schnell noch die Haare schneiden, so kurz wie möglich, denn ein neuer Termin ist nicht in Sicht. So wie jetzt habe ich zuletzt als Pimpf im Hitler-Staat ausgesehen. Überhaupt erinnert mich jetzt manches an jene finsteren Zeiten: die Reglementierung, die Abhängigkeit von amtlichen Anordnungen, die Angst vor dem Ungewissen. Als im März 1940 die ersten englischen Brandbomben in München fielen, grassierte zugleich eine gefährliche Frühlingsgrippe.
21. März 2020
Ein grauer, nasskalter Samstag. Trotzdem treibt es immer noch Ahnungslose, Hemmungslose und Dummköpfe in Grüppchen auf die leeren Straßen. Die Polizei meldet bis Mittag bei 60 Kontrollen bereits zehn Verstöße gegen die neuen Regeln. Die Gesamtzahl der Corona-Kranken hat in München erstmals die Tausender-Marke überschritten.
22. März 2020
Die Stadt scheint nun völlig ausgestorben zu sein. Und erstarrt. Keine Menschenseele begegnet mir am Morgen auf dem Weg zum St.-Anna-Platz. Vielleicht liegt es an der klirrenden Kälte. Unsere große Pfarrkirche ist geöffnet, aber menschenleer. Ein paar Kerzen flackern. Ausgehängt ist ein Dekret von Reinhard Kardinal Marx, wonach alle öffentlichen Gottesdienste in der Erzdiözese München und Freising bis 1. April abgesagt sind. Ebenso Hauskommunion, Krankensalbung und sogar Totenmessen. Doch sollen die Kirchen für das persönliche Gebet offenstehen. Die Weihwasserbecken sind leer. Die Matthäuspassion ist „verschoben“. Ein Anschlag klingt tröstlich: „Wir sind da – gerade jetzt“.
Wie wäre es, schießt es mir durch den Kopf, in dieser Zeit der Monotonie, da doch alle Museen zu haben, einige der sonst nicht so beachteten Kunstschätze in Münchens Kirchen zu besuchen? Man könnte sich auch an frühere Katastrophen erinnern, die in so manchem Gotteshaus dokumentiert sind, im alten Haidhauser Kircherl etwa zur Cholera-Epidemie von 1836 mit 2994 Toten.
Um 10 Uhr läuten die Glocken aller katholischen Kirchen der stillgelegten Stadt. Sie rufen zum Gebet und wohl auch zum Gedenken an die bisher 21 Toten der Corona-Pandemie in Bayern. An diesem Sonntag stirbt im Klinikum Großhadern der erste Münchner, ein 56-jähriger Mann, der eine Vorerkrankung hatte.
25. März 2020
Das tägliche Leben pendelt sich auf einem niederen Niveau ein. Stadt auf Sparflamme. Leben am Limit - Life light. Im Amtsdeutsch heißt das „Reduktion der sozialen Kontakte“. Die Menschen schleichen wie scheu aneinander vorbei, gehen sich aus dem Weg, damit der gebotene Abstand von 1,50 bis zwei Meter gewahrt bleibt. Manche lächeln sich zu, reden aber kaum. Im Großmarkt ein ähnliches Bild: Warten, bis Distanz möglich wird, Ware aus dem Regal greifen und zahlen - alles möglichst mit dünnen Handschuhen. Trotzdem bleiben die Verkäuferinnen und Verkäufer, die einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Helden hinter der Kasse, lobt eine Zeitung.
Wir Alten aber können mit dem Wort „Helden“ wenig anfangen, wenn sie zurückdenken an die Kriegsjahre, als die Menschen „Volksgenossen“ genannt, still und selbstverständlich ihre verdammte Pflicht taten.
Damit wir, die Risikogruppe also, nicht den in Supermärkten eventuell grassierenden Viren ausgesetzt sind, hat der Münchner OB Dieter Reiter dazu aufgerufen, Senioren eigene Einkaufszeiten zu ermöglichen. Mein Asiate drüben liefert abends sogar komplette Menüs „to go“, den Preis hat er leicht angehoben. Fortan beschränken sich meine Ausgänge aufs Essen holen und Luft schnappen, wie es uns die Kanzlerin empfohlen hat. Wenig Unterschied zu Knast und Kaserne. Allmählich kommt man sich tatsächlich etwas eingesperrt vor, wenn man so am Stück „dahoam“ hockt.
„Was mich an der Krise am meisten beschäftigt, ist die Zwangsisolierung“, schreibt mir Gerd, mein alter Freund aus der Abendzeitung. „Wir beugen uns allen Auflagen, die tief in unsere Privatsphäre einschneiden, weil wir keinen besseren Schutz vor der unsichtbaren, aber schrecklich erkennbaren Bedrohung sehen. Ich spreche von den Opfern, die um Atem ringend in ihren Sterbebetten liegen, von nächtlichen Lastwagenkonvois mit Corona-Leichen auf dem Weg zur Sammelstelle. Von unserem angstvollen Verkriechen in die letzte private Schutzzone, dem eigenen Heim.“
Allmählich kommt man sich tatsächlich etwas eingesperrt vor, wenn man so am Stück „dahoam“ hockt. Man fühlt sich isoliert oder, falls in Quarantäne, sogar stigmatisiert. In manchen Familien, die in kleinen Wohnungen gepfercht sind, scheint sich aus dem Nichtstun eine Art Feiertags-Grant zu entwickeln. Sozialhelfer befürchten, dass häusliche Gewalt zunehmen könnte.
26. März 2020
„Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.“ Rilkes elegischen „Herbsttag“ kommt mir in den Sinn, als ich diese Menschen beim Frühlings-Spaziergang an der Isar sehe: eine Gruppe von Obdachlosen mit erbärmlichem „Hausrat“ sucht Schutz am angestammten Lagerplatz, dem Kiosk mit seinem ausragenden Pilzdach. Ja, wer jetzt kein Heim hat und allein ist, den trifft es besonders hart. Wo bekommen sie nun was zu essen? Wo sollen sie sich waschen? Wie sollen sie bei nächtlichen Minusgraden schlafen, ohne sich aneinander kuschelnd zu wärmen? Restaurants, auch Suppenküchen, Tafeln und sogar Notunterkünfte sind ja zu.
Vor der evangelischen Lukaskirche treffe ich Toni aus Fürstenfeldbruck, 60 Jahre alt, zerzaust, struppig,  freundlich. Den Geldschein nimmt er mit knappem Dank an, die festen Schuhe nicht. Sie sind zu klein. Punkt 14 Uhr wird das Tor geöffnet. Toni schiebt den Einkaufswagen mit seinem Hausrat die Treppe hoch und verschwindet im dunklen Gotteshaus. Er will sich, nach schlechter Nacht, noch ein bisschen hinlegen. Corona fürchtet er nicht.
freundlich. Den Geldschein nimmt er mit knappem Dank an, die festen Schuhe nicht. Sie sind zu klein. Punkt 14 Uhr wird das Tor geöffnet. Toni schiebt den Einkaufswagen mit seinem Hausrat die Treppe hoch und verschwindet im dunklen Gotteshaus. Er will sich, nach schlechter Nacht, noch ein bisschen hinlegen. Corona fürchtet er nicht.
27. März 2020
Nicht nur für Wohnungslose wird die Grundversorgung immer mehr zu einem praktischen Problem, sondern auch für alleinstehende Senioren, wie ich einer bin (und sechs Millionen Bundesbürger). In den viel zu engen Gängen zwischen den Regalen der kleinen Edeka-Filiale drängen sich die Leute nach wie vor ängstlich aneinander und an den immer noch ungeschützten Kassierern vorbei. In anderen Vierteln sind die Verkäuferinnen schon durch eilig gezimmerte und mit Klarsichtfolie bespannte Verschläge abgeschirmt.
„Auch die überall sichtbaren Klebestreifen mit der Eineinhalb-Meter-Abstand-Markierung werden uns womöglich in Zukunft erhalten bleiben,“ meint Gerd, mein alter Kollege. Ihm ist außerdem aufgefallen, „dass immer wieder besonders eifrige Menschen in guter alter Blockwart-Manier ihre Mitbürger auf das Einhalten der Anstandsregel aufmerksam machen, da schwillt mir wieder der 68er-Kamm.“
Ich werde mich nach einem größeren Laden oder nach einem Lieferdienst umschauen müssen. Mit dem Nötigsten versorgt mich heute noch mein Sohn Thomas, der seine freie Zeit als Fotograf ohne Aufträge zum Sortieren und Digitalisieren uralter Negative nutzt respektive totschlägt.
„ALLES WIRD GUT. WIR BLEIBEN ZUHAUSE“ hat ein Kind auf Papier gemalt, das es mit einem Regenbogen verziert und ins Fenster gehängt hat. Nach den viel gerühmten Beispielen in Italien hat auch im Münchner Glockenbachviertel der 28-jährige Chorleiter Kilian Unger begonnen, seine Nachbarn von Haus zu Haus zum Mitsingen oder Musizieren einzustimmen. Begonnen hat das trotzige Hofkonzert am Sonntag mit „Freude, schöner Götterfunke“; es folgte der Beatle-Song „All you need is love“.
Die Zahl der Infizierten in Bayern hat heute die magische Marke 10 000 übersprungen.
28. März 2020
Wieder herrliches Ausflugswetter. „Sport und Bewegungen an der frischen Luft“ sind ja ausdrücklich erlaubt, wenn auch nur allein oder im gebotenem Abstand zu Haushaltsmitgliedern. So überleg ich die Möglichkeit, eine der bayerischen Corona-Kirchen zu besuchen. Die nächstgelegene soll sich bei Sauerlach befinden, nur 22 Bahnkilometer vom Hauptbahnhof München entfernt. Aber: Wie voll sind die Waggons, wird man darin die nötige Distanz wahren können? Verkehren überhaupt BOB-Züge, nachdem der Fahrplan stark ausgedünnt wurde? Ist die Kapelle im Wald zu Fuß zu erreichen? Ist sie überhaupt auf? Gottlob ist die Inschrift, die jene Kapelle birgt, schließlich auch im World Wide Web zu finden: „Müder Wanderer stehe still, mach bei Sankt Corona Rast. Dich im Gebet ihr fromm empfiehl, wenn Du manch‘ Kummer und Sorge hast." Wie aktuell alte Kirchentafeln doch sein können!
So verzichte ich halt lieber auf den Ausflug. Ich will die Frühlingssonne an diesem Wochenende einfach auf dem häuslichen Balkon genießen. Und lesen.
Drunten an der Isar mache ich eine weniger verstörende, wunderliche Wahrnehmung: Viel mehr Joggerinnen und Jogger als gewöhnlich traben durchs Grüne. Die Botschaft der Kanzlerin, in Bewegung zu bleiben, scheint mindestens bei jüngeren Bürgern angekommen zu sein.
Abends leuchtet aus allen Wohnungen das Licht, denn alle Leute sind zuhause. Ob wohl die  Geburtenziffern zu Anfang nächsten Jahres zunehmen werden? Ich suche nach einem kleinen Lichtblick im offiziellen Tagesbericht, werde aber enttäuscht. Wieder gibt es 293 Neuinfizierte in München, die Gesamtzahl steigt somit auf 2080 Fälle.
Geburtenziffern zu Anfang nächsten Jahres zunehmen werden? Ich suche nach einem kleinen Lichtblick im offiziellen Tagesbericht, werde aber enttäuscht. Wieder gibt es 293 Neuinfizierte in München, die Gesamtzahl steigt somit auf 2080 Fälle.
29. März 2020
Nun doch, da Sonntag ist, ein kleiner Abstecher in einen ruhigen, eigenständigen Villenvorort. An der Einfahrt nach Planegg hängt, allen Auto- und Radfahrern gut sichtbar, ein Schild am Zaun mit der Aufforderung: „Bleibt's dahoam“.
1. April 2020
Seltsam, wie die aktuelle Politik von der Krankheit überlagert wird. Corona von früh bis spät, Corona hier, Corona dort. Die Kanzlerfrage, gestern noch Schlagzeile? Vergessen. Die Aktienkurse? Lächerlich. Sogar die durchaus spannenden Ergebnisse der bayerischen Kommunalwahlen sind in den Hintergrund gerückt. Klar, dass die populären Macher der Großparteien und ihr Anhang begünstigt und die populistischen Miesmacher abgebremst wurden.
Dies ist die Stunde der leistungs- und entscheidungsstarken Politiker. Sie alle verdienen Hochachtung und Dank für den unermüdlichen Einsatz an der Corona-Front mit wenig Schlaf. Geduld, Tapferkeit, Empathie aber auch im Volk, bei Groß und Klein. „Ich arbeite an Designprojekten und mache viel Sport, ansonsten gehen mir soziale Kontakte ab“, schreibt auf einer bemalen Karte meine Enkeltochter Tania, die mich aus Ansteckungs-Sorge nicht mehr besuchen will, auf ihren Dienst bei der Lufthansa verzichten muss und zuhause Yoga übt. Aus Mexiko berichtet Nichte Elsa, die ihre Arbeit in der Schweizer Botschaft abbrechen musste.
Die 2000er-Grenze an Infizierten ist in der Stadt überschritten. Und zu allem Unglück sind noch einmal zwei Münchner, beide über 66 Jahre alt, der grausamen Seuche erlegen. Die hat München jetzt härter im Griff als alle anderen deutschen Städte.
Die Menschen aber zeigen ein neues, anderes Gesicht. „Seid nett zueinander,“ lautete einmal eine in Hamburg ausgegebene Parole. Wirklich, man ist merklich „nett“ zueinander, ich nehme das vor allem bei den Frauen in meiner Nachbarschaft wahr. Unaufgefordert schenkt mir die Chefin meiner Wäscherei eine richtige Mundschutzmaske, eine mit Luftfilter und Ausbuchtung für die Nase.
Bei meinen Spaziergängen und Einkäufen lege ich das Ding an. Und merke, dass ich weit und breit noch fast der Einzige bin, der derart vermummt ist. Was vielleicht daran liegt, dass diese Masken noch nicht leicht zu haben sind. Etliche Ärzte sollen deshalb ihre Praxis geschlossen haben und Münchner Krankenhäuser mussten sich Tausende von Atemschutzmasken aus China besorgen.
Zweitens fällt mir auf, dass mich manche Passanten scheu, fast ängstlich anschauen., wie ein Gespenst. Was vielleicht an mangelhafter Aufklärung liegt. Daran, dass diese Leute meinen, nur Infizierte würden oder müssten ihr Gesicht dergestalt einhüllen. Österreich hat Masken bereits für Einkäufe zur Pflicht gemacht. Jedenfalls will ich, mit oder ohne Mundschutz, weiterhin auf die Zwei-Meter-Distanz achten.
Recht nett ist die Idee eines Nachbarn vom „Osterkorb“. Bei mehreren Läden kann jedermann einen Gutschein erwerben für Geschenkkörbe, die dem Personal in Münchens Krankenhäusern und Pflegeheimen als kleines Dankeschön überreicht werden sollen. Vielleicht sollte man aber erst mal die hart geforderten Helfer ausreichend mit Schutzartikeln ausrüsten.
2. April 2020
Was tun "dahoam", wenn man nicht zum Homeoffice verbannt ist? Christian Ude will endlich die Bücher lesen, „die man das Jahr über geschenkt bekam“. Wie unser kulturbestrebte Alt-Oberbürgermeister, so dürften jetzt viele der Eingeschlossenen in ihren Regalen stöbern, Spitzwegs „Bücherwurm“ lässt grüßen. Ich selbst suchte gestern nach Lektüre, die das Leben im Ausnahmezustand schildern oder gar erklären, und stieß auf drei Romane, die alle mal Furore gemacht haben.
Diese drei Thriller könnten auch heute noch mehr Furcht als Fakten vermitteln: Die Pest vom Franzosen Albert Camus, Zentrum des Schreckens vom Engländer Graham Green und Hot Zone vom Amerikaner Richard Preston. „Tödliche Viren aus dem Regenwald“, so der Untertitel. Auf Seite 343 lese ich: „Sie sitzen auf Türgriffen und Telefonhörern, Büchern und Betten, Geldscheinen und Kaffeetassen, hocken auf Schuhen und Fingerspitzen, lauern auf Tieren und Pflanzen, schweben auf dem Wasser und im Wind. Zu Abermyriaden bevölkern sie den gesamten Globus ...“
Zeit der Literatur also? Eine Autorin liest ihren Fans ihre Gedichte am Telefon vor. Andere Schriftsteller nutzen Streaming-Kanäle als Transportwege. Buchhändler empfehlen ihre Lieblingsschmöker per Print oder Online-Plattform, notfalls bringen sie den Kunden die Bestellungen persönlich ins Haus. Chefredakteur Kurt Kister von der Süddeutschen berichtet heute aus seinem „Heimatbüro“ von einem Sinologen in Niederbayern, der nicht nur ihm fast jeden Tag selbst übersetzte chinesische Gedichte mit Bezug zur Gegenwart mailt.
Es sieht tatsächlich danach aus, dass die Literatur ausgerechnet in dieser Zeit einer „geschlossenen Gesellschaft“ (Sartre) mit Hilfe neuer Medien neue Dimensionen aufspürt. An einen langfristigen Gewinn glaube ich allerdings nicht. Abgesehen davon, dass die Vorstellung auch meines neuen Buches Münchner Meilensteine letzten Freitag dem Virus zum Opfer gefallen ist, erscheinen mir alle diese „Streamings“ (Strömungen) für die Hersteller und die Händler von Büchern zunächst nur als Not- oder Auswege, bestenfalls als Experimentierfelder.
Die Lage sei gerade für die Kulturschaffenden extrem bedrohlich, eröffnet mir ein Verlagsleiter aus dem „temporären Exil“. Von den Großhändlern kommen ganze Paletten retour. Derzeit unverkäuflich. Verkaufen lässt sich fast nur noch über den Superkonzern Amazon, den mein Verleger „Krisengewinnler“ nennt. Jener konzentriert seine Buch-Lieferungen aber erst mal auf Güter des täglichen Bedarfs. Ein anderer Verlag nennt mir einen Absatzrückgang von aktuell 80 Prozent. Ganz schlechte Aussichten haben für ihn Reiseführer und „Titel zu Ferndestinationen“. Ein Kleinverleger fragt mich schier verzweifelt: „Wer könnte in diesen Tagen schon von sich behaupten, diese 'biblische Plage' und ihre Konsequenzen annähernd zu begreifen?“ Tenor all der Mail-Mitteilungen: Buchhonorare sind bis auf Weiteres nicht zu erwarten.
Witzig klingt indes die heutige Meldung, der PEN-Club verlange die sofortige Wiederöffnung der Buchhandlungen. Die Begründung: “Der Mensch lebt nicht von Brot und Klopapier allein, er braucht auch geistige Nahrung!”
Gut, dass die periodischen Medien keinerlei Einschränkung erkennen lassen. Zeitungen, Radio und Fernsehen erleben geradezu eine Hochkonjunktur, denn der Nachrichtenstoff lässt wahrlich nicht nach, das Interesse der Leser, Hörer und Zuschauer auch nicht.
Freilich gibt es nur ein Thema. Dieses wird am späten Nachmittag als Kurzmeldung aus dem Gesundheitsamt zusammengefasst: Binnen 24 Stunden 173 Neuinfizierte in München und 2002 in Bayern, das nunmehr unter den Bundesländern die meisten Corona-Fälle hat, von rund 80 000  ziemlich genau ein Viertel.
ziemlich genau ein Viertel.
Söder erkennt einen „leicht positiven Trend“, der aber noch nicht ausreiche, um die Beschränkungen zu lockern.
3. April 2020
Täglich - wie Thomas Mann mit seinem Hund Bauschan - raffe ich mich mit Binde vorm Mund zu Spaziergängen an der Isar auf. Sie sind inzwischen ritualisiert. Einmal rechts und einmal links am Flussufer entlang, über eine der Brücken, durch die Anlagen drüben und auf einer anderen Brücke zurück. Ich gehe langsamer als früher. Das Niedrigwasser hat Kies-Zungen geformt, die von ersten Sonnenanbetern besetzt sind. Tag für Tag öffnen sich die Knospen ein bisschen. Der Frühling ist da.
Und der Leierkastenmann ist wieder da. Was war das doch für ein Spaß, wenn unten im Hof ein Mann mit einer Drehorgel oder einer Quetsche erschien und volkstümliche Lieder spielte, bis in die graue Kriegszeit hinein. Die Mutter wickelte dann ein Zehnerl oder mehr in Papier, das wir dem oder den Hofmusikanten vom Balkon runterwarfen. Vergelt's Gott, dankten die. Gestern nun gab es eine Erscheinung aus der Vergangenheit. Im Hof einiger Seniorenheime ließ der - gerade 100 Jahre alt gewordene Münchner Schausteller-Verein eine alte Jahrmarktsorgel schieben und bespielen. Was für eine Abwechslung für die alten Leute, die nicht mehr besucht werden dürfen.
Die öffentlichen Spaßmacher leiden selbst arg unter der Krise. Alle traditionellen Termine sind abgeblasen; das Frühlingsfest im April, die Dult im Mai, das Magdalenenfest im Juli. Und sogar dem Oktoberfest im September, das der Stadt immer eine ungeheure Bürde aufgehalst, ihr aber auch viel Geld gebracht und Millionen von Menschen aus ihrem Alltag gelöst hat, droht das Aus. Um den Standl-, Fahrgeschäft- und sonstigen Betreibern sowie den Marktfrauen ein wenig beizustehen, hat die Stadt heute eine Aktion „Dult ist Kult“ verkündet. Für neun Euro kann man sich Gutscheine kaufen, die zu einem Wert von zehn Euro auf jedem künftigen Jahrmarkt umgesetzt werden können. Irgendwann, irgendwo in München.
4. April 2020
Ein sonniges Wochenende liegt vor uns. Wir wollen es wieder durch erlaubte Spaziergänge nutzen. Erste Erfahrungen zeigten: der Englische Garten, die Stadtparks, die Isarpromenaden – überall „drängt sich ein buntes Gewimmel hervor“, wie auch schon Meister Faust bei seinem Osterspaziergang  bemerkte. Deshalb lenken wir unsere Schritte in den totenstillen Waldfriedhof. Wir finden das Grab von Frank Wedekind. Bei seiner Bestattung im Kriegsjahr 1918 - als die Spanische Grippe über München herfiel - hatte unser Skandaldichter letztmals einen Skandal verursacht; Im Beisein berühmter Trauergäste wie der Mann-Brüder und des Jungdichters Brecht setzte der junge Autor Lautensack zum Sprung ins offene Grab an.
bemerkte. Deshalb lenken wir unsere Schritte in den totenstillen Waldfriedhof. Wir finden das Grab von Frank Wedekind. Bei seiner Bestattung im Kriegsjahr 1918 - als die Spanische Grippe über München herfiel - hatte unser Skandaldichter letztmals einen Skandal verursacht; Im Beisein berühmter Trauergäste wie der Mann-Brüder und des Jungdichters Brecht setzte der junge Autor Lautensack zum Sprung ins offene Grab an.
Am Samstag ist in München die Zahl der Neuzugänge auf 145 gefallen, um am Sonntag wieder auf 195 Fälle anzusteigen.
6. April 2020
Heute würden die Osterferien beginnen, aber, nachdem Bayern vorgeprescht war, sind die Schultore ja schon seit drei Wochen geschlossen. Unterrichtet wurde trotzdem, indem die Lehrer den vorgeschriebenen Stoff per E-Mail oder Whatsapp vermittelten. Arbeiten ohne „social contacting“. Auch in diesem Bereich haben neue Anglizismen wie „Homeschooling“ oder „Homelearning“ den deutschen Sprachschatz angereichert. Dabei handelt es sich doch nur um das gute alte „Hausaufgaben machen“.
Auch zu meiner Schulzeit war der Unterricht im Schulhaus oft ausgefallen. Zunächst schon deshalb, weil eine Lehranstalt nach der andern in Trümmer fiel. So entwickelte sich eine regelrechte Wanderschule. Als der Krieg dann – genau 75 Jahre ist es her! – zu Ende ging, ging auch der Schulbesuch zu Ende. Wir wurden quasi zu Zwangsarbeitern „umgeschult“, nur so gab es Lebensmittelmarken. Den Sommer 1945 „genoss“ ich in einer Münchner Marmeladenfabrik und auf zwei oberbayerischen Bauernhöfen. Erst im September waren diese Notferien beendet und ich durfte mich im Gymnasium, wie die Oberrealschulen nun hießen, aufs Abitur vorbereiten.
7. April 2020
München hat jetzt 16 Corona-Tote. Täglich und genau melden alle Medien die Neuinfizierten sowie die Gesamtzahl der erkannten Virusträger, der Genesenen und der Toten, manchmal auch die der Getesteten und der intensiv betreuten Patienten. Ich selbst aber möchte jetzt die Wiedergabe dieser Statistik einstellen, denn die Zahlen werden zum Zahlengewirr. Von mehreren Instituten für unterschiedliche Zeitspannen auf Grund unterschiedlicher Kriterien - aus München, Bayern, Deutschland und der Welt - werden die Meldungen zusammengetragen, hochgerechnet und durch farbige Kurven markiert.
Allmählich wird das medizinische Problem auch ein mathematisches Problem. Eine Rechenaufgabe mit vielen Unbekannten ist sie jedenfalls für den Laien. Er kann wenig anfangen mit diesen neuen Werten, etwa der „Basisreproduktionszahl“. So erfährt man täglich den Zeitraum, in dem sich die neu bestätigten Infekte da und dort verdoppeln, was letztlich über die Kontaktsperre entscheiden soll. Mich erinnert das an die ominöse „Halbwertszeit“, die bei Atombombentests und Reaktorkatastrophen für radioaktive Luftpartikel galt.
Nicht die Statistik, sondern der menschliche Faktor findet unser Alltagsinteresse. Vorhin rief mich mein alter Freund Hans N. aus dem Seniorenheim an. Er fühle sich gut versorgt und langweile sich kein bisschen, versichert er. Nur dürfen ihn halt seine Kinder nicht mehr besuchen. Und wenn ihm die Apotheke seine Medikamente bringt oder wenn er einen Handwerker baucht, muss er beim Klingeln erst eine Pflegerin rufen, die dann behandschuht die Tür öffnet. Als Reisejournalist war Hans einst in der ganzen großen Welt zuhause.
8. April 2020
Beim Überlesen der Lokalseiten in den Zeitungen irritieren neuerdings nicht nur die wechselnden, meist wachsenden und recht unterschiedlichen Fallzahlen, sondern auch die polizeilichen Maßnahmen, die dagegen  ergriffen werden. Offenbar werden vom Polizeipräsidium und vom Innenministerium fast stündlich neue Parolen ausgegeben, die sich in Details unterscheiden und teilweise sogar widersprechen.
ergriffen werden. Offenbar werden vom Polizeipräsidium und vom Innenministerium fast stündlich neue Parolen ausgegeben, die sich in Details unterscheiden und teilweise sogar widersprechen.
Die uniformierten Kontrolleure werden daher von halb informierten Spaziergängern laufend befragt: Darf ich mich jetzt eigentlich auf einer Parkbank ausruhen und wie lange und mit wie vielen Begleitern? Darf ich auf der Wiese liegen oder dort gar die Brotzeit auspacken, die ja wohl zum „täglichen Bedarf“ zählt? Darf ich einfach nur eine Weile stehen oder muss ich ohne Pause gehen? Die Hauptfrage lautet: Was bitte sind triftige Gründe?
Die Reaktionen sind so unterschiedlich wie die Verlautbarungen. Meist wird man freundlich belehrt, mal wird hart durchgegriffen, manchmal auch abkassiert. Da kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass polizeilicherseits eine gewisse Willkür obwaltet. Schon hagelt es böse Leserbriefe von Leuten, die an die DDR erinnern, oder gar an die Nazi-Zeit, als polizeilicherseits jegliches „Rasen betreten verboten“ war.
Meine Begleiterin aber äußert aus anderthalb Meter Entfernung durchaus Verständnis für die ungeklärte Zwangslage: „Lieber a bisserl z'vui aufpassen als z'wenig.“ Mindestens sollte das für jenen Zeitgenossen gelten, der trotz mehrmaliger Ermahnung und einer vorläufigen Festnahme immer wieder seine sieben Sachen im Englischen Garten ausbreitete, weil es ihm um die Freiheit geht.
Nebeneffekt: Die Aufmerksamkeit des Publikums hat sich ein wenig von den Patientenzahlen auf die öffentlichen Parks verlagert, von den Betten auf die Bänke.
9. April 2020
Heute vor 75 Jahren wurde der Theologe Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg ermordet. Die Evangelische Jugend Bayerns hat eine ungewöhnliche Gedenkfeier organisiert: Jugendliche in ganz Europa haben das große Lied hochgeladen, das der Todgeweihte in der Zelle geschrieben hat: "VON GUTEN MÄCHTEN WUNDERBAR GEBORGEN; ERWARTEN WIR GETROST; WAS KOMMEN MAG". Heute soll das Lied - gemeinsam, vielstimmig und mehrsprachig gesungen, gesprochen oder musiziert werden und über die sozialen Medien gesendet.
Wenn einem nach drei Wochen „Hausarrest“ die Decke des Wohnzimmers auf den Kopf zu fallen droht, dann bleibt nur ein Fluchtweg: hinaus ins Freie. Open air erwartet uns ja immer noch so viel von dem Schönen, das die Dichter künden: Vogelgezwitscher, linde Lüfte, blauer Himmel, Frühlingsgrün. Und weil Karfreitag bevorsteht, zieht es uns aus grauer Städte Mauern wieder zu einem Friedhof, dem in Penzberg. Auch hier ist zu erinnern an ein 75 Jahre zurück liegendes Ereignis – an das furchtbare Ende einer politischen Seuche.
Am 28. April 1945, zwei Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner in München und im südlichen Bayern, wurden 15 Penzberger Männer und eine schwangere Frau von Männern der Wehrmacht und des „Volkssturms“ auf Befehl erschossen oder erhängt, weil sie ihr Bergwerk vor der Sprengung retten wollten und mehrere Nazi-Bonzen festnahmen. Ihre 16 Gräber sind unter einer Hecke aufgereiht, gegenüber eine Steintafel mit der Inschrift: VERWEILE IN GEDENKEN VOR UNSEREM GRABE UND KUENDE DEN DEINEN WIE WIR STARBEN IN TREUE ZUR HEIMAT.
Kreuz und quer durch die oberbayerische Heimat fahren wir zurück nach München. Alle Züge und Busse verkehren pünktlich, in den Wagen sitzen höchstens vier Fahrgäste im gebotenen Abstand voneinander. Keine Kontrolle, alle Auskünfte freundlich, Ansteckungsgefahr gleich null. Corona ist weit entfernt. Ein Hoch auf den Öffentlichen Personennahverkehr. „Wenn es in der übrigen Welt drunter und drüber geht, dann bleiben Euch in Deutschland immer noch Ordnung und Fleiß, und deshalb werdet ihr bestimmt besser als andere aus dem Schlamassel rauskommen", tröstet mich meine Schwester in ihrem Ostergruß aus Mexiko.
12. April 2020
Zu Ostern wage ich einen Blick in die mögliche Zukunft. Wenn das alles vorbei ist - was dann? Die schon lange kursierende Standardfrage dürfte zum Fest der Auferstehung das Thema zahlreicher virtueller Predigten sein, es wird wohl auch familiäre Kaffeetische und soziale Netzwerke beherrschen.
Ja, was wird sein „nach Corona“?. Bisherige Spekulationen, die sich auf Hochrechnungen, Erfahrungsberichte und Analysen berufen können, bewegen sich zwischen düsterem Fatalismus. Geduldsübungen und schierem Optimismus. Die übergreifende Antwort lautet: Alles wird anders sein, wirklich alles: das Individuum, die Politik, die Gesellschaft.
Von all den Visionen gefällt mir eine besonders. Der deutsche Zukunftsforscher Matthias Horx sagt ein Zurück zum einfachen Leben voraus, welches ohnehin längst fällig wäre. Alte Kulturtechniken sowie das Handwerk würden eine Renaissance erleben. Man werde wieder von Mensch zu Mensch kommunizieren. Aus der körperlichen Distanz werde eine neue Nähe - was ja eigentlich ein Paradox ist. „Die Welt wirkt wieder jung und frisch und wir sind plötzlich voller Tatendrang.“ So weit die Horx-Hymne. Das wäre dann eine echte Kulturrevolution, ja, es wäre die Ansage einer neuen Gesellschaft, wie sie Philosophen und Ideologen seit Urzeiten erträumen.
Sollte die Causa Sars Covid-19 wirklich ein derart zündender Götterfunke sein? Meine vorläufige Antwort klingt banal: „Nix G'wiß woas ma net.“. Oder, um es im bayerisch-chinesichen Mix eines Münchner Spielers und Denkers auszudrücken: „Schau ma moi.“
Für mich ist die Ostern-Bilanz jedenfalls ein Anlass, zur Kurzarbeit überzugehen - wie 2,7 Milliarden arbeitende Menschen auf diesem Globus, die laut Internationaler Arbeitsagentur vom 8. April von den Corona-Maßnahmen betroffen sind. Dieses Tagebuch soll nur noch sporadisch fortgeführt werden.
20. April 2020
Die offizielle Maskenpflicht beginnt in Bayern zwar erst kommende Woche, noch herrscht nur ein regierungsamtliches „Gebot“, also eine dringende Empfehlung. Jedenfalls bewegen sich aber jetzt schon immer mehr Menschen mit Masken in München. Dabei sind selbst die einfacheren Modelle zum Beispiel in Apotheken kaum unter 19.90 Euro zu haben. Obendrein scheint der Massenbedarf trotz der Importe und gern kolportierter Firmengeschenke noch längst nicht gedeckt zu sein. Noch sind Masken Mangelware.
Darum gehen kreative Münchner, Frauen zumal, selbst ans Werk. Aus Kleiderstoffen, Schals oder sogar aus Schlüpfern werden allerlei Mundnasenschutztücher geschneidert. Viele sind nicht weiß wie Windeln, sondern ziemlich bunt. Manche Damen haben sie ganz ihrer Garderobe angepasst. Und manche Männer sehen aus wie Seeräuber oder, mit schwarzem Gesichtsvorhang, wie gefährliche Wüstenkrieger. Ein Trachtengeschäft ließ die Konterfeis des Märchenkönigs Ludwig, der Märchenkaiserin Sisi und des Macherkönigs Markus auf weiß-blau kariertes Tuch drucken.
Ob alle diese Leute wissen, dass man mit derartigen Modellen Marke „Community“ in der Regel zwar die anderen vor den teuflischen Teilchen schützen kann, kaum aber sich selbst? Dieses leisten angeblich nur  höherwertige Ausführungen und natürlich der für das medizinische Personal gefertigte Nasen-Mund-Schutz Marke FFP, der keinerlei Viren durchlassen soll. Egal, Masken sind Mode geworden. Und diesbezüglich marschiert München allemal in der Avantgarde.
höherwertige Ausführungen und natürlich der für das medizinische Personal gefertigte Nasen-Mund-Schutz Marke FFP, der keinerlei Viren durchlassen soll. Egal, Masken sind Mode geworden. Und diesbezüglich marschiert München allemal in der Avantgarde.
Die staatlich gewünschte Maskerade hat allerdings einen dunklen Hintergrund. Nach jüngstem Stand lebt jeder Vierte der 142 180 bisher in Deutschland bekannten Corona-Infizierten in Bayern, entweder im Krankenhaus oder in Quarantäne oder er gilt als genesen. Noch höher ist ein anderer Anteil: Bayern betrauert 1271 der 4396 Toten in Deutschland. In diesem Nachbarland von Tiroler Virusherden war vor drei Monaten (24. Januar) der erste Deutsche positiv getestet worden, hier auch war vor vier Wochen (20. März) erstmals – bevor die übrige Republik nachzog - „das öffentliche Leben runtergefahren“ worden, wie sich Ministerpräsident Söder deutlich ausgedrückt hatte.
Noch düsterer wird das Bild, wenn man in der Süddeutschen Zeitung eine erschütternde Reportage liest, die aus dem Krankenhaus des – wegen der Grenznähe besonders betroffenen - Landkreises Rosenheim berichtet: von Ärzten, Schwestern und Pflegern, die Unmenschliches leisten müssen, und von Corona-Patienten, die dennoch qualvoll sterben.
Mit wachsender Ungeduld erwartet man nun allseits die angekündigten Lockerungen. Am gestrigen Sonntag habe ich aus dem Netz einen Bing-Crosby-Song geholt, der mich in der Besatzungszeit sehr begeistert hatte: „Don't fence me in“ - Sperrt mich nicht ein.
21. April 2020
Sehr schmerzt ausnahmslos alle das von Söder und Reiter sichtlich wehmütig verkündete Aus für das Münchner Weltsymbol, welches Wiesn heißt und weit mehr ist als eine große Gaudi. Zwar haben Seuchen und Kriege dieses Oktoberfest schon mehrmals verhindert, jetzt aber hatten viele Bürger und Betroffene bis zur Stunde auf ein Wunder gehofft: dass sie und die übrige Welt die ganze Misere, den Frust, die Angst der letzten Monate auf dem größten Volksfest der Welt doch noch „obischwoam“ können, dass sie neuen Lebensmut feiern können wie einst die tanzenden Schäffler nach der Pest.
27. April 2020
Haidhausen war von jeher das Stadtviertel mit den vielen kleinen Häusern, kleinen Leuten und kleinen Läden. Erstere, die von Krieg und Wiederaufbau übrig gebliebenen Herbergen, wirken jetzt, da keine Autos und kaum Menschen in Sicht sind, wirklich wie Kulissen der Vergangenheit. Letztere, die seit heute wieder geöffneten Läden, offenbaren das, was man neuerdings „neue Normalität“ nennt.
Fortan wird es also normal sein, vor Geschäften zu warten, bis man - natürlich nur mit Mundnasenschutz - eingelassen wird. Denn auf einer Grundfläche von 20 Quadratmetern darf sich jeweils nur ein Kunde aufhalten. Dem Geschäftsinhaber drohen bis zu 5000 Euro Bußgeld, wenn er nicht auf die entsprechenden Distanzen achtet. Und der Kunde soll 150 Euro zahlen, wenn er in einem öffentlichen Verkehrsmittel nicht wenigstens einen Schal vors Gesicht gebunden hat. Das kann ja noch kompliziert werden.
Friederike Wagner vom „Buchpalast“ in der Kirchenstraße ist jedenfalls heilfroh, dass sie ihre Bücher nun nicht mehr selbst austragen muss. Sechseinhalb Wochen lang hat sie bestellte Titel bis zu ihren Kunden gebracht und an der Haustür geklingelt, wie telefonisch oder per Mail vereinbart. Was für Bücher waren denn gefragt? „Die einen wollten Corona durch Unterhaltung verdrängen, aber viele verlangten extra einschlägige Literatur,“ sagt die Buchhändlerin. „Die Pest“ von Albert Camus sei derzeit vergriffen. Auf die beliebten Lesungen muss der „Buchpalast“ - ein ironisch übertriebener Firmenname - bis auf weiteres verzichten.
Geschlossen bleibt in der Kirchenstraße das nicht weniger beliebte Haidhausen Museum, während der Friedhof ein Stück weiter oben besucht werden darf. Gleich am Eingang, umwuchert von Efeu, zwei Gedenksteine für die 3246 Toten der beiden Cholera-Wellen, die vor allem diesen Vorort im 19. Jahrhundert heimgesucht hatten, und noch ein drittes Mahnmal mit einer Inschrift von 1984: „Vor Seuchen, Krieg und Katastrophen, vor der Zerstörung der Umwelt, vor Unglaube und geistiger Verwirrung bewahre uns oh Herr.“
Auch mein Friseur Martin darf noch nicht wieder aufmachen. Er mag auch gar nicht. „Ich arbeite nicht. Ich renoviere. Ich habe Respekt,“ hat er trotzig an die Tür geschrieben. Daneben hängen Vorschriften, wie sie für die im Mai erwartete Wiedereröffnung gelten sollen: Kunden und Friseure nur mit Maske. Rasieren, Wimpernfärben und Bartpflege vorerst nicht erlaubt. Markierungen für die „einzelnen Bewegungsräume“. Keine Zeitungen. Desinfizierung nach jedem Besuch. Der Hair Stylist vis-à-vis scheint indes mit den Auflagen klar zu kommen. „Don't panic“, plakatiert er, und „Modelle" sucht er auch.
Beim Bezirksausschuss Haidhausen-Au hängt noch die Einladung zur nie stattgefundenen Bürgerversammlung aus. Dabei wäre es eher um Lappalien gegangen wie um die Ampelregelung und die Anschaffung einer Schaufel für die – seit sechs Wochen geschlossene – Kita. Auch um die Gastronmie im Viertel hätten sich die BA-Mitglieder gekümmert, zum Beispiel um eine Sperrzeitverlängerung und die Erweiterung einer Freischankfläche. Die benachbarte Escobar bittet die – nicht mehr vorhandenen Gäste – immer noch, „nach 23 Uhr nicht mehr so laut zu sein.“ Probleme, die von einem größeren Problem verdrängt wurden.
Ruhe herrscht in den Geschäfts- und Aufenthaltsräumen der Straßenzeitung BISS. Die letzte Ausgabe, die den Rassismus aufs Korn nahm, wird nicht mehr verkauft. Und die Trauerfeier für einen Verkäufer wurde abgesagt. „Aber alle unsere Leute sind stabil, sie bekommen ihr kleines Gehalt weiter,“ sagt Geschäftsführerin Karin Lohr draußen auf der unbelebten Straße. Und all die anderen „Bürger in sozialen Schwierigkeiten“ (abgekürzt: BISS), die Hunderte von Obdachlosen in München? „Denen geht’s schlecht.“
Neue Normalität auch am Wiener Platz. Alle Kioske nach wie vor geschlossen, es sind ja keine kleinen Geschäfte, sondern gastronomische Betriebe. Doch der Hofbräukeller hat sein eisernes Tor geöffnet, obwohl  im Biergarten sämtliche Tische und Stühle weggeräumt sind. Mehr als ein halbes Jahrhundert verbindet mich mit dieset Bierburg. 1944 hatten Militärärzte uns Oberschüler hier auf Kriegstauglichkeit gemustert. Bald nach Kriegsende hatten im selben noch intakten Festsaal die US-Besatzer erste Popkonzerte für die Münchner Jugend arrangiert. Das war uns wie ein letzter Akt der Befreiung nach langer Knebelung erschienen.
im Biergarten sämtliche Tische und Stühle weggeräumt sind. Mehr als ein halbes Jahrhundert verbindet mich mit dieset Bierburg. 1944 hatten Militärärzte uns Oberschüler hier auf Kriegstauglichkeit gemustert. Bald nach Kriegsende hatten im selben noch intakten Festsaal die US-Besatzer erste Popkonzerte für die Münchner Jugend arrangiert. Das war uns wie ein letzter Akt der Befreiung nach langer Knebelung erschienen.
Dann saß ich dort viele Sommer lang mit meinen Spezln unter den Kastanien, wir amüsierten uns über das alte Weiberl mit dem Brotzeitkörberl und dem immer gleichen Sprücherl: „Frische Brezen, scheener Herr.“ Tief unten im Keller lockte bis in jüngste Zeit hinein ein Tanzlokal mit exotischem Namen und nostalgischen Melodien, und noch ein Stockwerk tiefer spielte die beste Karl-Valentin-Truppe Bayerns den Ritter Unkenstein und andere Stückerl in köstlicher Neufassung.
Was wird - außer der Erinnerung - von alledem bleiben? Friedrich Steinberg, der Wirt, plant längst für eine vielleicht doch noch bald mögliche Saison. Unverändert guter Service bei strikter Hygiene, Distanz und personeller Verknappung – das soll die Geschäftspolitik bestimmen. Vom derzeitigen Stamm, 95 Mitarbeiter, würde wahrscheinlich ein Drittel „wegbrechen“ und von den 800 Sitzplätzen im Biergarten fast die Hälfte, kalkuliert Steinberg. Immerhin hat die Brauerei, das staatliche Hofbräu, großzügig von Fest- auf Umsatzpacht umgestellt.Dabei verkauft HB derzeit 40 Prozent weniger Bier auf dem deutschen Markt und in anderen Ländern fast gar nichts mehr.
Um wenigstens seine Stammgäste zu halten, lässt Pächter Friedrich Steinberg an den offenen Theken jeden Mittag zehn verschiedene Gerichte ausgeben. Darunter natürlich auch jenes Schmankerl, das sein Großvater, der „Hendlkönig“ Friedrich Jahn, einst der halben Welt schmackhaft gemacht hatte. Schön und gut, aber wo essen? Auf dem Betriebsgelände darf man sich nicht aufhalten, Bier gibt's sowieso nicht dazu. Und auf dem Wiener Platz sind die Bänke schnell besetzt. So kauf ich mir statt des Brathendls lieber eine Büchse mit Saurem Lüngerl, das ich mir zuhause warm machen werde.
4. Mai 2020
„Die Wirtschaft wird ungeduldig“ titelt heute die Süddeutsche Zeitung. Die Ungeduld erfasst aber nicht nur die nach wie vor einflussreichen Verbände von Handel und Industrie, die hart betroffenen Gewerbetreibenden von den kleinen Kneipiers bis zu den Bossen der großen Konzerne. Ungeduldig, ja unruhig werden am Beginn des zweiten Monats nach den ersten Hiobsbotschaften auch Teile des bis dato folgsamen Bürgertums. Immer häufiger meldet die Münchner Polizei seit dem 1. Mai „stationäre Veranstaltungen“, wie sie jetzt das unangemeldete, unerwünschte Zusammenrotten von Bürgern ein bisschen verharmlosend bezeichnet.
Erst sind es ein paar Gesinnungsfreunde, die sich per Netz oder Telefon zu Kundgebungen verabreden. Neugier vergrößert dann den Kreis. So kamen vor dem Nationaltheater immerhin 320 Münchner zusammen, um gegen die „Aufhebung von Grundrechten“ zu protestieren. Offenbar waren auch Pegida-Anhänger darunter, ihr Schlachtruf „Wir sind das Volk“ deutete darauf hin. Vor dem Rathaus versammelten sich etwa 200 Menschen. Hier hatten Impfgegner das Wort und man hörte allerlei Verschwörungstheorien über „geheime Kräfte“, die das Virus ins Abendland eingeschleppt haben sollen wie vor Kurzem noch die Flüchtlinge. Ähnliche, organisierte oder spontane Pseudo-Demonstrationen gab es auf anderen repräsentativen Plätzen der Landeshauptstadt. Dort aber überwogen eher diffuse Ängste vor einer dauerhaften Stornierung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit.
In der Regel begnügt sich die Polizei zunächst damit, die versammelten Menschen zu informieren und auf die Abstandsregeln hinzuweisen. In einigen Fällen kam es aber auch zu Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Überhaupt scheinen viele Ordnungshüter über die ihnen zugewachsene Rolle der Spaßverderber nicht recht glücklich zu sein, wenngleich sie nicht mehr gegen Buchleser auf Bänken einschreiten müssen. Peter Schall, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, äußerte sich jedenfalls kritisch über die anhaltend strikten Kontaktbeschränkungen; er hält sogar eine gewisse Öffnung der Biergärten für machbar und vertretbar.
Nach weiterer, allerdings nur geringer Lockerung der rigorosen Einschränkungen zu Wochenbeginn – sie betreffen vor allem den Kirchgang, den Sport, Versammlungen und Kinderbetreuung - setze ich meinen Erkundungsgang im Münchner Osten fort und komme zum Klinikum rechts der Isar, der Technischen Universität München - so der offizielle Name mit dem etwas rätselhaften Logo MRI. Auch hier gilt strenges Besuchsverbot, Notfälle und dringende Operationen natürlich ausgenommen. Zur Zeit werden 60 Covid-19-Patienten stationär, teilweise intensiv versorgt.
Mehrere wichtige Studien zur Erforschung und Eindämmung der Pandemie haben soeben im Klinikum rechts der Isar begonnen. Die 1834 gegründete „Haidhauser Armen- und Krankenanstalt“ hat sich längst nicht nur zu einer großen Krankenstadt entwickelt, sondern auch zu einem international beachteten Forschungszentrum. Immer wieder sind deren Ärzte in neue Bereiche der Medizin vorgestoßen. Bei namhaften Chirurgen lag ich dort selbst unter dem Messer, meist nach Ski-Unfällen, einmal nach einem Gleitschirm-Absturz und noch 2019 nach zwei besonders bösen Unfällen (Fahrrad und Kajak).
Einige meiner Operateure spielten auch in Politik und Gesellschaft eine Rolle. Thomas Zimmermann, der meine kaputte Schulter wiederherstellte, saß für die CSU im Landtag. Simon Snopkowski, bei dem ich mein rechtes Bein nach einem komplizierten Drehbruch drei Wochen lang in Gips hing, war Präsident der Israelitischen Kultusgemeinden Bayerns und Senator. Chefarzt Professor Georg Maurer war einflussreicher CSU-Stadtrat. Er wurde berühmt, als er die beim Flugzeugunglück im Februar 1958 schwer verletzten britischen Fußballstars betreute. Maurer organisierte auch alljährlich den Chirurgen-Kongress mit oft sensationellen Themen – und überwarf sich 1969 mit rebellischen Assistenzärzten.
Mithin war das äußerlich etwas altmodische, immer wieder angestückelte Krankenhaus für mich sowohl Station einer Art Überlebensschule als auch eine Quelle interessanter Berichte über Fortschritte in der Medizin. Jetzt steht „Rechts der Isar“ im Kampf gegen die weltweit grassierende Lungenkrankheit wieder einmal mit an der Spitze der weltweiten Forschungsgemeinde. Zwei große Studien haben dieser Tage begonnen.
Nicht weniger als 7000 freiwillige Mitarbeiter des Haidhauser Krankenhauses und anderer Einrichtungen sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre auf Antikörper, die sich bei Infektion gebildet haben, serologisch untersucht werden. Die Professoren Percy Knolle und Paul Lingor wollen dadurch herausfinden, welchen Risiken das Klinikpersonal ausgesetzt war und wie lange Antikörper gegen eine erneute Infektion schützen können. Auch für die Entwicklung eines Impfstoffes soll diese Arbeit hilfreich sein.
Ein weiteres, dank Spenden beschleunigtes Forschungsprojekt am Klinikum soll klären, ob ein Monitoring von Covid-19-Infizierten durch Ohren-Sensoren die Überlebenschancen verbessern und Intensivstationen entlasten kann. Erkrankte über 60 Jahre, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, können freiwillig teilnehmen. Die rund um die Uhr gemessenen Daten sollen Auskunft darüber geben, wie gut der Körper die Auswirkungen der Erkrankung kompensieren kann. Münchens Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs verspricht sich eine zusätzliche Sicherheit für Erkrankte der älteren Generation, die mit leichten Symptomen zuhause bleiben könnten und nicht im Krankenhaus behandelt werden müssten. Das wäre die große Mehrzahl, denn bisher haben nur 13 Prozent der Infizierten so schwere Symptome, das eine stationäre Behandlung erforderlich ist.
11. Mai 2020
Plötzlich ist sie wieder da, die beinahe schon vergessene Kultur. Der sogenannte Bayernplan der Staatsregierung, der sie neben Zoos und Botanischen Gärten unter ”Freizeit” listet, erlaubt ihr ab heute  wieder die Öffnung. Wenn auch nur in Teilbereichen. Zeitgleich mit Großkaufhäusern, Golfen, Segeln und Reiten. Nach einer Zwangspause von fünfzig Tagen startet am Wochenende die Abteilung Musik und Theater. Allerdings nur mit einem ersten kleinen öffentlicher Auftritt. Denn einen offziellen Öffnungstermin gibt es für diese beiden Bereiche noch nicht.
wieder die Öffnung. Wenn auch nur in Teilbereichen. Zeitgleich mit Großkaufhäusern, Golfen, Segeln und Reiten. Nach einer Zwangspause von fünfzig Tagen startet am Wochenende die Abteilung Musik und Theater. Allerdings nur mit einem ersten kleinen öffentlicher Auftritt. Denn einen offziellen Öffnungstermin gibt es für diese beiden Bereiche noch nicht.
Für die angemeldete Veranstaltung hat das Kreisverwaltungsreferat ein Stück Kapuzinerstraße autofrei gemacht. Penibel halten sich die Urbanauten, die sonst wegen ihrer Isarlust- und Isarbad-Projekte oft mit den Behörden streiten, an die strengen Auflagen für ihre Veranstaltung. Je eine Person, möglichst aus einer benachbarten „häuslichen Gemeinschaft“, darf auf einem der aufs Pflaster gemalten Kreidekreise stehen oder herum hüpfen, die vorgeschriebenen Distanzen sind gewahrt. Für die Rockband von Dr. Will ist sogar ein Abstand von fünf Metern vorgesehen, „denn die Aerosole von Musikern könnten etwas weiter sprühen“, sagt Oberurbanaut Benjamin David. Das klinge lustig, habe aber einen ernsten Hintergrund.
Eine gute Stunde lang schwitzen nicht nur Musikanten, sondern auch Tänzer, Trommler und eine bunte Stelzenläuferin für eine freie, offene Kunstausübung. Auf Autospuren und Gehsteigen ist Platz für maximal 50 Personen, die Polizei drückt ein Auge zu. Auf Balkonen beobachten weitere Zuschauer die demonstrative Darbietung, die so recht in das immer etwas alternative Glockenbachviertel passt. Sie läuft unter dem Motto „Kulturlieferdienst“. Der sammelt – auch hier – Spenden für Auftritte von arbeitslosen Künstlern vor Senioren-, Pflege- und Flüchtlingsheimen.
Sogar der Lebensbereich, den Markus Söder jetzt gern als „Gastro“ listet, spielt ein bisschen mit bei dem Straßenspektakel. Eine italienische Eisdiele bietet Gelati in allen Farben des Regenbogens, während die „Speis Sisters“ nebenan Speis und Trank ausgeben, natürlich nur „take away“. Am Rand des improvisierten Open-Air-Stage rauscht indes der Verkehr über die Kreuzungen am Baldeplatz, gleich dahinter rauscht die Isar. Alles beinahe wie eh und je.
Musiker mit Visieren zur Virenabwehr
Zur gleichen Stunde bietet Sabine Rinberger im Turmstüberl des Karl-Valentin-Musäums eine virtuelle, aktuelle Bühne. Bekannte Volksschauspieler und Kabarettisten lesen – jeder an einem eigenen Tischchen - aus Dokumenten über München nach der Befreiung vor 75 Jahren. Die Zitate lassen das Leben in Corona-Zeiten relativ erträglich erscheinen. Manches ist bisher kaum bekannt, zum Beispiel die von Selbstmitleid triefenden Bekenntnisse des Komikers Weißferdl und des Komponisten Richard Strauss, die der unermüdliche Christian Springer gefunden und sortiert hat.
Indes entwirft der nicht weniger kreative Christian Stückl in seinem Volkstheater ein Konzept, um der Bühnenkunst noch vor der Wiedereröffnung der Häuser auf die Bretter zu helfen. Er will in seinem großen Haus jede zweite Sitzreihe und jeden vierten Platz entfernen und die Musiker im Orchester mit Visieren zur Virenabwehr ausrüsten. Die Spielzeit, die eigentlich bis Ende September pausiert, soll auf Mitte Juli vorgezogen werden. Die fünf Stücke des Spielplans will Stückl zeitlich kürzen, auf die Gefahr hin, „dass die Corona-Aufführungen furchtbar fad werden“.
Deutlich geringere Erwartungen hegen Dietmar Lupfer und Christian Waggershauser. „Die Politik hat uns vergessen,“ klagen die Manager der Münchner Hallenkultur. Wird man jemals wieder auch nur annähernd solche Menschenmassen wie früher unterbringen und unterhalten können in der riesigen Muffathalle und anderen Relikten der alten Industriezeit, deren Umwidmung und Unterhalt, vor allem zugunsten jüngerer Bürger, die Stadt sich sehr viel Geld kosten ließ? Ist dort Verkleinerung samt konsequenter Hygiene technisch möglich? Wohin sonst mit den großen Popkonzerten, mit Poety-Slam, Tanz-Performance, Installationen, Diskussionen, Clubabenden? Bricht etwa ein Stück Alternativ-Kultur einfach weg? Geisterspiele wie beim Fußball wären hier jedenfalls keine Lösung.
Ausstellungshallen und Museen dagegen haben - in der „neuen Normalität“ - wieder eine Zukunft. Zuerst kann das Haus der Kunst, das keine Montagsruhe kennt, das Ventil öffnen. Andrang wäre zu erwarten. Doch zunächst ist das eigens geschulte Personal unter sich: der Personenzähler am Eingang, die Kassendamen hinter Plexiglas, die maskierten Saaldiener. Unbeachtet liegen die vielfarbigen Baumwollballen von Franz Erhard Walther in der großen Halle, ungehört bleibt die akustisch belebte Raumkapsel namens „Zugzwang“ von Sung Tieu. Vielleicht ist es der Maskenzwang, der potenziellen Besuchern den Kunstgenuss verdrießt, zumal wenn die Brille beschlägt. Jedenfalls starten in den nächsten Tagen alle Münchner Kunsthäuser guten Mutes. Einige der laufenden Ausstellungen wurden sogar verlängert. Einzelne Museumsteile bleiben geschlossen, etwa die engen historischen Räume der Villa Stuck. Auf den gewohnten Imbiss muss überall verzichtet werden.
18. Mai 2020
Großalarm wegen einer Großdemo. Nicht weniger als 10 000 Menschen wollte die Veranstalterin, eine Immobilienmaklerin, für Samstag anmelden. Erlaubt wurden nur tausend, mit strengen Auflagen, nachdem eine "Hygiene-Kundgebung" auf dem Marienplatz von zugelassenen 80 auf 3000 Teilnehmer angewachsen war. Tatsächlich wird an den Zugängen genau gezählt und lange vor Demo-Beginn hermetisch abgesperrt. Auf einem Geviert der Theresienwiese, von der heuer das Oktoberfest verbannt wurde, sind kleine Kreuze aus Papier auf dem Boden geklebt, in Abständen von anderthalb Metern. Freundliche junge Ordner dirigieren die Andrängenden dorthin, wo sie auch brav bleiben.
Verschwörungsprediger und rechte oder linke Radikalinskis sind nicht in Sicht, nur ein paar Impfspinner. Aber haufenweise Coronagefahr-Leugner und Zahlen-Zweifler, Wutbürger der anderen Art, viele bewaffnet mit  Protestplakaten gegen "Notstandsgesetze" und die Abschaffung von Bürgerrechten auf Dauer. Frauen sind deutlich in der Überzahl. Eine, die sich als Ossi bekennt, erinnert an die Hongkong-Grippe vor 20 Jahren mit etwa 40 000 Toten in beiden Deutschlands. Damals hätten Politiker und Medien auf Panikmache verzichtet, im Gegensatz zu heute, da Depressionen und Existenzängste in noch nicht abzusehendem Maße systematisch erzeugt würden. Ähnlich bedenkenswert dann Argumente weiterer Redner.
Protestplakaten gegen "Notstandsgesetze" und die Abschaffung von Bürgerrechten auf Dauer. Frauen sind deutlich in der Überzahl. Eine, die sich als Ossi bekennt, erinnert an die Hongkong-Grippe vor 20 Jahren mit etwa 40 000 Toten in beiden Deutschlands. Damals hätten Politiker und Medien auf Panikmache verzichtet, im Gegensatz zu heute, da Depressionen und Existenzängste in noch nicht abzusehendem Maße systematisch erzeugt würden. Ähnlich bedenkenswert dann Argumente weiterer Redner.
Große schwarze Blocks säumen den Bavariaring. Offenbar gilt die Parole: So viele Protestler - so viele Polizisten. Alle vermummt, einige hoch zu Ross. Nur mit Ach und Krach gelingt den Einsatzkräften die Auflösung von Grüppchen ausgesperrter, unmaskierter und eng zusammenstehender Zaungäste, deren Zahl ihr Chef auf 2500 schätzt. Auch die Würde von Polizistinnen und Polizisten gelte es zu achten, mahnt die Hauptrednerin einzelne Buh-Rufer. Fast friedlich endet nach einer guten Stunde das Spektakel, das ein Modell sein könnte für das Demonstrieren in Corona-Zeiten.
Eher unbeachtet bleiben indes die immer noch laufenden, meist privat organisierten Veranstaltungen zum Gedenken an die Befreiung von der Nazi-Herrschaft vor 75 Jahren. Dabei ergäben sich einige Parallelen: So wie jetzt ein Stück Normalität nach dem anderen wiederkehrt, so war ab Mai 1945 in diesem "lebendigen Schutthaufen", wie München vom spätere OB Thomas Wimmer bezeichnet wurde, das richtige Leben neu erwacht, nur, dass dies damals nicht unter der Losung "Lockerung" lief: Nach und nach machten Behörden, Buchhandlungen und Banken, Kirchen, Kinos und Krankenhäuser wieder auf. Im Juni gab es das erste Fußballspiel (FC Bayern gegen FC Wacker), im Juli folgten Trambahn, Post und das erste große Konzert. Im Bürgerbräukeller, den hungrige Münchner und befreite "Fremdarbeiter" eben noch geplündert hatten, wurde bald sogar wieder Bier ausgeschenkt - allerdings nur an amerikanische Soldaten.
19. Mai 2020
Bier her – das ist neben den Demos das zweite Großthema aktuell. Am Montag dürfen die „Freischankflächen“ in ganz Bayern wieder öffnen. Doch so einfach lässt sich das urbayerische Verlangen nicht verwirklichen. Beim Viktualienmarktbiergarten, einer meiner Stammlokale, muss  man Schlange stehen, um einen der reduzierten Plätze unter den Kastanien zugewiesen zu bekommen. Auch darf man die mitgebrachte Breze am Tisch nicht verzehren, und zu essen gibt’s sonst weit und breit nichts. Darob vergeht mir erst mal der Appetit.
man Schlange stehen, um einen der reduzierten Plätze unter den Kastanien zugewiesen zu bekommen. Auch darf man die mitgebrachte Breze am Tisch nicht verzehren, und zu essen gibt’s sonst weit und breit nichts. Darob vergeht mir erst mal der Appetit.
Indes sind vor dem Holz-Bistro am Stadtmuseum gerade noch zwei Stühle leer. Der Wirt hat sein Freigelände penibel vermessen. Erst nachdem wir Name, Adresse und Telefonnummer eingetragen haben, reicht uns der Wirt eine in Folie eingeschweißte Speisenkarte, die er danach desinfizieren soll. Lieber wäre ihm, dass man den QR-Code am Eingang scannt und vorzeigt, und dass man bargeldlos bezahlt. Die Preise hat er etwas angehoben, jetzt kostet der Flammkuchen 15 Euro. Die Senkung der Mehrwertsteuer gelte erst ab 1. Juni, brummt der Chef hinter seiner Maske. Die meine müsste ich bei einem Gang zur Toilette auch anlegen. An den Getränkepreisen ändere sich eh nichts. Ob es ihm hilft, dass neun bayerische Großbrauereien, wie diese in Großanzeigen werben, eine Million Maß Gratisbier an „unsere Wirte“ spendieren wollen?
Bleibt den monatelang zugesperrten Gastronomen immerhin die etwas vage Zusage der Stadt München, bei einer Verbreiterung von Freischankplätzen großzügig zu verfahren und das Aufstellen von Kiosken, Karussells und anderen, vorerst nicht nutzbaren Jahrmarktattraktionen dulden zu wollen, wozu jeweils Parkplätze geeignet wären. Fraglich, ob all das den mit Mehrkosten und Mehrarbeit verbundenen Hygiene-Aufwand auch nur ein wenig aufwiegen kann. Einer der Traditionswirte im Tal hat bereits das Handwerk geworfen. Und wir alle, die wir gern Gäste waren, werden uns wohl oder übel an eine neue Normalität auch in der Gastronomie gewöhnen müssen.
25. Mai 2020
Auch bei der Mobilität werden wir uns an eine neue Normalität gewöhnen müssen. Beizeiten vor dem Neustart des Ausflugs- und Urlaubsverkehrs zu Pfingsten - aber auch im alltäglichen Stadtverkehr - zeigen sich zu Lande und in der Luft deutliche Verlagerungen an. Was bisher vor allem die Grünen angestrebt und nur teilweise erreicht haben, scheint nunmehr einer unsichtbaren Mikrobe zu gelingen. Politiker und Planer sehen sich vor vielfache Herausforderungen gestellt.
Von meinem Arbeitszimmer aus kann ich beobachten, wie der breite Isarradweg von Tag zu Tag stärker bevölkert wird. Das heißt, immer mehr Münchnerinnen und Münchner steigen um, schwingen sich auf den Sattel und strampeln sich frei von der so lange verordneten Immobilität. Die Radler-Kreuzung an der Maximiliansbrücke (wo ich vor 75 Jahren den Einmarsch der Amerikaner miterlebt habe) ist auch für Fußgänger gefährlich geworden, zumal hier obendrein Jogger übersetzen und Kraftfahrzeuge rechts abbiegen. Wie dicke Werbebeilagen beweisen, boomen Fahrrad-Verkauf, -Verleih und -Reparatur. Neu im Angebot sind Lastenräder für Besorgungen, Cargo-Bikes genannt. Sie erinnern an die „Roten Radler“ aus Ludwig Thomas „Münchner im Himmel“.
In und um München belebt sich der Verkehr nur langsam
Deutlich abgenommen hat dagegen der Autoverkehr, zum Beispiel auf meiner sonst sehr belebten Widenmayerstraße, die mal eine Stadtautobahn werden sollte. An der Flaute auf den Fahrbahnen hat sich wenig geändert, seit Söder das öffentliche Leben wieder „hochfahren“ ließ. Selbst auf den Autobahnen rund um München belebt sich der - zunächst stark zurückgegangene - Verkehr nur langsam, Obwohl doch, wie die Autobahndirektion Südbayern meldet, viele Leute „Schritt für Schritt aus dem Home-Office zurückkommen“ und die Züge des Öffentlichen Personennahverkehrs immer noch mieden. Dabei heben Deutsche Bahn und Privatbahnen schon am 18. Mai den Regelbetrieb auf allen südbayerischen Netzen wiederaufgenommen.
„Corona hat unser Mobilitätsverhalten verändert,“ beschreibt der Münchner Stadtrat Nikolaus Gradl die noch kaum absehbare Entwicklung. Seine SPD-Fraktion hat deshalb beantragt, Autospuren bestimmter, viel befahrener Straßen in Radlfurten, sogenannte Pop-up-Lanes umzuwandeln. Mein Bezirksausschuss Altstadt-Lehel hat eine „Entleerung des Zentrums“ festgestellt; Er fordert auf Antrag der Grünen eine „Neuordnung und mögliche Umwidmung des Straßenraums“. Nach dem Vorbild von Brüssel. Endziel der rot-grünen Stadtregierung ist jetzt eine autofreie City.
Natürlich erhebt sich Widerstand gegen derart radikale Veränderungen, vor allem seitens CSU, FDP, Bayernpartei und ADAC. Neue Fronten im Ringen um Freiheits- und Bürgerrechte tun sich auf. Einigen Autofans sind dabei offenbar die Sicherungen durchgebrannt. Das zeigt sich etwa daran, dass die Polizei immer öfter illegale Rennen meldet. Was wiederum den Bundesverkehrsminister nicht hindert, auf eine Lockerung der Sanktionen für Autoraser zu drängen. Am selben Tag verdeutlichen zwei Meldungen in der Abendzeitung, dass die Nerven nach längerer Demobilisierung nicht nur bei frustrierten Autofahrern blank liegen: “Rentner bedroht Frau und Tochter mit Pistole“. Und: „Mann zielt mit Waffe aus dem Fenster.“
Eine andere Verkehrsebene: der Flughafen Franz Josef Strauß. Oft und oft habe ich über das „Monster im Moos“ berichtet, über seine leidvolle Vorgeschichte, über die vielen Probleme und großartigen Prognosen. Immer seltener dann habe ich mich, nachdem ich meine Reisen auf die mitteleuropäische Umgebung Münchens beschränkt habe, in die Warteschlagen an einem Check-in-Desk, vor der Sicherheitskontrolle und draußen vor dem Gate gedrängt. Und jetzt? Ich will mich mal umschauen.
27. Mai 2020
Gespenstisch: Riesige, fast menschenleere Hallen, die vor Kurzem noch Drehscheiben der Welt waren. Ungewohnte Ruhe, keinerlei Hektik wie früher. Leere Schalter und Geschäfte. Die Sparkasse hat auf, vier Damen sitzen hinter Glas, wollen aber nicht verraten, wie viele Kunden an so einem Tag abgefertigt werden. Auch die paar sonstigen Läden sind leer. Nichts los im Erdinger Moos. In Terminal 1 und im neuen Satellitengebäude ruht jeglicher Betrieb. Sogar der Besucherpark ist geschlossen, soll aber an Pfingsten wieder zugänglich sein; „Tante Ju“ bietet dort dann sogar Speisen und Getränke „to go“ an.
Abgefertigt wird nur im Terminal 2. Theoretisch. Fluggäste oder Flugbegleiter sind jedenfalls nicht zu erblicken. Immerhin zeigt die Anzeigetafel ein paar Abflüge an, von Amsterdam bis Riga. Pfingsten naht, normalerweise eine große Reisezeit. „Zurzeit zählen wir etwa 2000 Passagiere pro Tag,“ verrät mir Ingo Anspach, der Pressesprecher des Münchner Flughafens. Er hält die Stellung, sein Team ist teilweise in Kurzarbeit. Zum Vergleich: Vor Corona waren hier täglich 120 000 bis 150 000 Personen abgeflogen und angekommen.
Im März noch, als die Zahl der Fluggäste schon um 65 Prozent gesunken war, arbeiteten mehr als 38 000 Menschen aus aller Herren Länder für Deutschlands zweitgrößtem Airport. 13 000 allein bei der Lufthansa, die jetzt nur noch 3000 Frauen und Männer stationiert hat. Eine einsame Stewardess in Zivil huscht vorbei und hofft, bald wieder eingesetzt zu werden, statt ein Logo zu basteln für die künftige zweite Stammstrecke der S-Bahn; auch die fährt momentan so gut wie leer heraus
Die Lufthansa leidet, trotz des Milliarden-Deals mit Berlin. Höchstens 50 Starts und Landungen fertigt sie nun täglich ab. Die meisten jener über hundert Flugzeuge, die weit draußen abseits des Rollfelds geparkt sind, tragen das Kranich-Logo. Orangerote Planen oder Folien schützen Triebwerke und andere Teile. Regelmäßig müssen die Maschinen zum Check-in den Hangar. Für Juni aber hoffen alle auf ein einigermaßen normales Take-off. Noch freilich sind große Teile der Start- und Landebahnen aufgerissen - gute Gelegenheit zum Ausbessern der strapazierten Betondecke und der Befeuerung.
Die Flughafenleitung ist überzeugt, „dass der globale Mobilitätsbedarf auf mittlere Sicht steigt“. Der Marketingspruch meint, dass der Luftverkehr wieder Höhen gewinne. Immerhin kam soeben die Zusicherung, dass die größte Fluggesellschaft Europas den Flughafen München als einzigen Standort für das größte Passagierflugzeug der Welt - 500 Plätzen auf zwei „Etagen“ - auserkoren hat. Alle acht bestellten Exemplare des Airbus 380 sollen künftig das Kreuz des deutschen Südens neu erstrahlen lassen. In einem Rundschreiben an die Mitarbeiter schätzen die Personalmanager der Lufthansa allerdings, dass die Corona-Krise noch bis 2023 den Flugverkehr belasten werde.
Halbwegs in Betrieb ist auf dem Flughafen, den die Statuen von Ludwig I. und von Franz Josef Strauß zieren, zurzeit allein der Airbräu. Mittags versammelt sich ein Teil des vor Ort verbliebenen Airport-Personals im Biergarten, der natürlich nach allen Regeln der Hygiene und der Social Distance funktioniert. Wieder zwitschern die Vögel in den Bäumen. Nur auf die Weißwürste, die mich früher nach jeder Heimkehr von fernen Zielen erquickt haben, muss vorerst verzichtet werden.
Um hiermit die Krise der Mobilität abzurunden: Flaute herrscht momentan auch noch auf Bayerns Ausflugsseen. „Wir gehen aber heute schon davon aus,“ meldete die Starnberger Personenschifffahrt zu Pfingsten, „dass die Beförderungskapazitäten reduziert werden müssen.“ Auch sei damit zu rechnen, dass die gesetzten Rahmenbedingen Auswirkungen auf den Fahrbetrieb haben werden. Das würde unter anderem Verspätungen und ein verzögertes Ein- und Aussteigen bedeuten.
2. Juni 2020
Liedermacher und Spaßmacher, Stehgeiger und Straßenmusikanten, Disk-Jockeys und Barmixer, Party- und Eventmanager – sie und viele andere Zubringer des vorwiegend abends oder nachts ausgeübten Unterhaltungsgewerbes fühlen sich nun schon allzu lange ausgegrenzt, vergessen von staatlicher und städtischer Fürsorge für bedrohte Existenzen. Alles nicht so wichtig? Kleinkunst, Kleinkram im Vergleich jedenfalls mit der noch bis 15. Juni geschlossenen Hochkunst (Theater, Konzertsäle und Kinos)? Vermisst allenfalls von notorischen Nachtschwärmern?
Vielleicht gelten aber doch andere Maßstäbe in einer Stadt, die sich immer, manchmal geradezu penetrant gewisser Traditionen (Stichwort: Schwabing) und ihrer besonderen „Freizeitqualität“ gerühmt und weltweit damit geworben hat. Als Korrespondent auswärtiger Zeitungen habe ich mich früher selbst gern an derlei Lobpreisung beteiligt.
Das von Kultusminister Bernd Sibler verkündete Hilfsprogramm, das bayerischen Künstlerinnen und Künstlern nach begründetem Antrag drei Monate lang je tausend Euro verheißt, findet nur wenig Applaus. Ein Künstlerverbund hält es für praxisfern und diskriminierend. Die Einnahmeverluste würden sich bis weit ins nächste Jahr auswirken. „Unverschämt“ nennt der Strauß-Kabarettist Helmut Schleich die Meinung des Strauß-Nachfolgers Söder, damit gäbe es nun kaum noch Einschränkungen im Kulturbetrieb. Sibler sieht indes nur ein „Konzept für einen Neustart von Kunst und Kultur unter veränderten Bedingungen“.
Ganz klein haben die Kleinkünstler inzwischen auf eigene Faust und Kosten und unter veränderten Bedingungen den Neustart gewagt. Kreativität, Mut, ja Idealismus sind da gefordert. In Wohnzimmern, Tonstudios oder auf Bühnen, beispielsweise im „Stemmerhof“, werden immer öfter  und perfekter Programme veranstaltet und per Livestream bisweilen mit Spendenbitte oder Bezahlschranke in die Wohnzimmer gesendet. Dafür bedarf jeweils der Anmeldung, die von der Landeszentrale für neue Medien stets unbürokratisch und kostenfrei genehmigt wird. Digitale Angebote dieser Art, meint Münchens Kulturreferent Anton Biebl, könnten künftig die Kulturszene bereichern.
und perfekter Programme veranstaltet und per Livestream bisweilen mit Spendenbitte oder Bezahlschranke in die Wohnzimmer gesendet. Dafür bedarf jeweils der Anmeldung, die von der Landeszentrale für neue Medien stets unbürokratisch und kostenfrei genehmigt wird. Digitale Angebote dieser Art, meint Münchens Kulturreferent Anton Biebl, könnten künftig die Kulturszene bereichern.
Technische und vor allem rechtliche Fragen wären aber noch zu klären. Kunst auf Antrag, Kleinkünstler als Rundfunkanbieter – wie geht das zusammen? Etliche Probleme tauchen auf. So musste das winzige „Hofspielhaus“, das die Falkenturmstrasse im Hofbräuhausviertel jeden Abend bespielt hatte, das schnell beliebt gewordene Programm zu Pfingsten stornieren, „da eine rechtliche Klärung der Rahmenbedingungen erforderlich ist“. Dagegen dürfen fortan die „Urbanauten“, die mit einem Straßenkonzert wie einst angeblich die Schäffler den Pest-Bann gebrochen hatten (siehe Notiz vom 8. Mai), allabendlich auf autofreien Straßenstücken ihren „Kulturlieferdienst“ darbieten, demnächst den „Flying Circus“. Einzige behördliche Bedingung: Zuschauer müssen sowohl in Abstand wie auch in Bewegung bleiben.
Die Schwabinger und Münchner Nächte sollen und könnten endlich wieder ein bisschen heller werden.
8. Juni 2020
Der Marienplatz ist wieder voll, die Menschen eilen und drängen wie einst. Auch Stadtführungen sind erneut angesagt. Vier Frauen und zwei Männer wollen „Liebe, Lust und Leidenschaft“ im alten München kennen lernen. Treffpunkt ist die von der Sparkasse der Schwesterstadt Verona gestiftete  Statue der Julia. Carmen Finkenzeller von „Stattreisen“ verteilt Schokoherzerl und macht gleich auf eine zeitbedingte Veränderung aufmerksam. Der Bronzebusen der schönen Braut des Romeo ist deutlich nachgedunkelt und nicht mehr so goldig poliert wie früher. Ein Indiz für das mehrwöchige Ausbleiben von Touristen, die – so die Mär - durch Berühren just dieser Brust ihr Liebesleben aufbessern konnten.
Statue der Julia. Carmen Finkenzeller von „Stattreisen“ verteilt Schokoherzerl und macht gleich auf eine zeitbedingte Veränderung aufmerksam. Der Bronzebusen der schönen Braut des Romeo ist deutlich nachgedunkelt und nicht mehr so goldig poliert wie früher. Ein Indiz für das mehrwöchige Ausbleiben von Touristen, die – so die Mär - durch Berühren just dieser Brust ihr Liebesleben aufbessern konnten.
Auf dem Marienplatz. im Rathaushof und im Alten Hof erzählt die Stadtführerin noch andere „Münchner Liebesgeschichten“, jeweils mit Hinweis auf Figuren und Inschriften. Schöne und grausige Geschichten. Auf weitere Assoziationen zu Seuche-Zeiten, die ja wenig mit Liebe zu tun haben, verzichtet sie aber. Immerhin befindet sich das bekannteste Symbol der Pest an der Südwestecke des neuen Rathauses: ein Gift sprühender Drache, und am Sockel der 1638 eingeweihte Mariensäule erscheint der Schwarze Tod in Gestalt eines mit Hahn und Schlange bestückten Basiliken.
Da die „Stattreisen“ und andere Führungen nach wie vor noch ohne Touristen stattfinden, kann Frau Finkenzeller ihre Erklärungen in waschechtem bairisch vortragen, ohne übersetzen zu müssen, wie gewohnt. Vorerst bleiben die Münchner unter sich. Die Stimmung sei gut, wird mir aus der Geschäftsstelle mitgeteilt. Eine 82-jährige Dame habe sich gefreut, dass sie jetzt wieder „sinnvoll unterwegs“ sein könne. Leider mache das Hygienekonzept persönliche Gespräche nicht ganz einfach.
„Gästeführer sind oft die Einzigen, mit denen die Besucher einer Region intensiv in Kontakt kommen. Sie prägen das Bild, das Gäste mit nach Hause nehmen. Mit ihrem Sachverstand, ihrer Vermittlungsfähigkeit und ihrer Authentizität tragen sie entscheidend zum touristischen Erfolg einer Region bei.“ So begründete der Münchner Gästeführerverein, dessen 200 Mitglieder in 30 Sprachen führen, in einem Brief an Ministerpräsident Söder die Bitte um Einbeziehung in das Künstlerhilfsprogramm (siehe Notiz vom 2. Juni).
Max Zeidler, der am Wochenende zum Thema „Migration“ führte, legte einen Meterstab auf den Boden, um das Abstandsgebot zu verdeutlichten. Am 30. Juni führen die „Stattreisen“ durchs Münchner Klinikviertel, das sich zur Zeit sehr verändert. Für das DGB-Bildungswerk recherchiert Heini Ortner einen Rundgang mit dem Thema „Gesundheitliche Versorgung in München im Mittelalter“, die mörderische Pest und die aus Afrika eingeschleppte Infektionskrankheit Lepra eingeschlossen. (Schon 1213 erwähnt die Stadtchronik das erste Leprosenhaus auf dem Gasteig).
Dezentralisierte Wiesn: Nicht jeder findet das gut
Das anhaltende Ausbleiben von Touristen, die üblicherweise ab Mai die bayerische Hauptstadt bevölkern, offenbart sich auch beim anschließenden Dämmerschoppen im Hofbräuhaus. Die Restaurants, Trinkstuben und der Festsaal in den oberen Stockwerken sind geschlossen. Leere Tische in der Schwemme, keine Blaskapelle, kein Oans-zwoa-gsuffa, kein Lärm fröhlicher Zecher, kein Aneinandervorbeidrängen, alle Kellner maskiert und ausnehmend freundlich, fast alle sind Ausländer. In den zehn Stunden, die das berühmteste Wirtshaus der Welt mit den bekannten Auflagen derzeit wieder geöffnet hat, kommen jetzt täglich etwa 600 Gäste, verrät der Mann am Eingangspult, der Namen und Telefonnummern notiert und Plätze zuweist. Gemütlichkeit geht anders.
In verschiedenen Phasen glaubt der Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU), dem die Organisation der heurigen Wiesn entgangen ist, den für München nicht ganz unwichtigen Tourismus im zweiten Halbjahr wieder ankurbeln zu können. Erst will er in der Großregion München werben lassen, dann in Österreich und der Schweiz, dann im übrigen Europa und schließlich wieder weltweit. Eine der Attraktionen soll ein vom Stadtrat beschlossenes Programm namens „Sommer in der Stadt“ sein, das auch der Gastronomie aus der Patsche helfen könnte. In Parks, vor Wirtshäusern, auf Parkplätzen, in verkehrsberuhigten Zonen und wo auch immer es möglich ist, sollen sich Schausteller und Standlbetreiber entfalten können. Ein dezentralisiertes Oktoberfest gewissermaßen, nicht von allen Traditionalisten gutgeheißen.
16. Juni 2020
Fast alle Münchner Museen haben wieder regulär geöffnet. Viele haben umgeräumt, alle haben hygienische Vorrichtungen und Führungslinien eingebaut, einige haben ältere Ausstellungen verlängert oder neue eröffnet. Doch auch in der vergangenen Zeit der Stille wussten sie ihre Schätze per Internet ansprechend, oft in nie gekannten Zusammenhängen, zu präsentieren. Die neue digitale Methode der Kulturvermittlung hat durchaus Zuspruch gefunden. Ich meine: Sie sollte nun – wie manch andere „Notlösung“ - systematisch weiterentwickelt werden.
Ein hervorragendes Beispiel dafür ist ein vom NS-Dokumentationszentrum gestalteter Rundgang. Vor Hinterlassenschaften des ehemaligen Parteiviertels und anhand bisher kaum bekannter Archivbilder berichtet die Direktorin Mirjam Zadoff über die Befreiung Münchens vor 75 Jahren. Interessant selbst für Zeitzeugen und Zeitungsmenschen, die den Einmarsch der Amerikaner am 30. April 1945 miterlebt und öfter über die Nachkriegszeit geschrieben haben. So wird der virtuelle Besucher in die sonst unzugänglichen Keller der beiden erhalten gebliebenen Nazipaläste am Königsplatz geführt, wo seinerzeit mindestens 600 wertvolle Gemälde sowie die Karteikarten von elf Millionen Parteigenossen und große Mengen Wein geplündert wurden. Das Virus als Schlüssel für ein Stück Zeitgeschichte.
Das Virus als Schlüssel für ein Stück Zeitgeschichte
„Das Museum wird als Raum sozialer Interaktion wieder lebendig", heißt es zu einer Aktion namens „1:1 mit Kunst, Design und Architektur“, die nunmehr jeden Sonntagnachmittag gespielt wird. An  festen Standorten in der Pinakothek der Moderne sprechen Kunstvermittler jeweils zehn Minuten lang mit einer Person, einem Paar oder einer Familie über ausgestellte Werke: ihre Wirkung, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten. Ein vorläufiger Ersatz für die noch nicht wieder möglichen Führungen. Die Warteschlangen am Haupteingang sind trotzdem nicht zu vermeiden.
festen Standorten in der Pinakothek der Moderne sprechen Kunstvermittler jeweils zehn Minuten lang mit einer Person, einem Paar oder einer Familie über ausgestellte Werke: ihre Wirkung, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten. Ein vorläufiger Ersatz für die noch nicht wieder möglichen Führungen. Die Warteschlangen am Haupteingang sind trotzdem nicht zu vermeiden.
Manches Kreative hat die Krise erzeugt, aber auch Initiativen, die man unter dem Stichwort „Corona-Kuriosa“ bündeln könnte. Interessenvertreter aller Art sehen sich veranlasst, ins allgemeine Klagekonzert einzustimmen. So haben 50 Hochzeitsdienstleister, denen ihr Geschäft derzeit etwas entschwunden ist, vor dem Rathaus eine 40 Meter lange Hochzeitstafel in Weiß aufgebaut, um ebenfalls „konkrete Staatshilfe“ zu erbitten. Vielleicht hilft da auch die Aktion „Socialmatch“: Fünf Frauen und fünf Männer treffen sich ab 22. Juni, nach Online-Vereinbarung, im Park-Café und lernen sich durch ein speziell entwickeltes Spiel kennen, möglicherweise fürs Leben.
Zwar dürfen jetzt in Bayern auch Hobby-Musiker wieder proben - höchstens jedoch zehn Personen inklusive Leitung, ohne Publikum, möglichst im Freien, Bläser drei Meter Abstand, Querflöten „auf Grund der höheren Luftverwirbelung“ am Rand platziert, alle 20 Minuten gründlich lüften. Besonders erzürnt sind die Chöre, die traditionelle Gemeinschaften bilden; sie dürfen überhaupt nicht üben, weil „lautes Singen mit erhöhter Infektionsgefahr verbunden ist“. Deutsche Präzision.
„Poesie gegen Corona Blues“ will eine Aktion der Künstlerin Katharina Schweißgut vermitteln. In einen rot lackierten Briefkasten in Giesing kann jedermann – fast nur Frauen machen mit - sein Empfinden von der Krise als „Getipptes, Gekritzeltes oder Kalligrafiertes“ einspeisen. Per YouTube-Video werden auch Gedichte gelesen, ernste und heitere. Zum Beispiel: „Stürmische Zeiten, Unruhe ist in der Welt. Kehrt Ruhe zurück?“ Oder: „Neuerdings herrscht überall, nicht nur in Bayern, Maskenball.“
Auf den Besuch bayerischer Biergärten werde ich bis auf Weiteres verzichten. Abschreckendes Beispiel: Chinaturm, sonniger Samstag. 12.30. Suchen des verschobenen Radstellplatzes sowie des einzigen Eingangs. Maske auf, Schlange stehen, Abstand. An Stehtisch ausgehändigten Meldezettel beschriften. Durch ein mit Signalbändern und Bodenpfeilen markiertes Labyrinth zu den Theken. Keine Weißwürst, nur große, zähe Brezn - und doch erhöhte Preise. Klaglos zahlen angesichts des Aufwands. Tisch 61 mit ausgehändigter Nummer suchen. Maske ab - zum Krug stemmen. Suche nach Desinfektion, weil inzwischen etliche Dinge angefasst. Umzug auf schattigen Platz nicht möglich. Einzige Lichtblicke: das tadellose Bier und das merklich gedrillte Personal. Stumm und allein betrachtet man die Tische rundum. Die meisten mit einzelnen oder gar keinen Gästen. Kein Wunder – auch nicht, dass ein Wirt nach dem anderen das Tischtuch wirft. Ach, wie war es doch vordem ...
22. Juni 2020
Heute endet der am 16. März von Ministerpräsident Markus Söder verkündete Katastrophenfall. Zeit also für weitere „Lockerungen“ der lästigen Corona-Zwänge. Gut, dass in den bayerischen Ministerien offenbar Brigaden von Beamten am Werk sind, um immer wieder neue Regeln auszutüfteln, wobei auch nicht das kleinste Detail vergessen wird. Auf minutiöse Arbeit deuten jedenfalls einige der Neuigkeiten hin: So dürfen künftig 100 statt nur 50 Personen miteinander feiern, Theater und Orchester im Freien vor 200 statt nur vor 100 Zuschauern spielen und Urlauber auch ohne eigenes WC im Wohnwagen campen. Und: Die Sperrstunde in Gaststätten wurde um eine Stunde auf 23 Uhr verlängert und der Mindestabstand in Kirchen von zwei auf anderthalb Meter verkürzt.
Nicht ganz so locker, aber ebenso genau wird die Krise in städtischen Behörden aufgearbeitet. Mit ihrem Team vom Statistischen Amt Münchens hat meine Nichte Angelika im monatelangen Home-Office aufgeschlüsselt und grafisch dargestellt, was sich im Wesentlichen im vergangenen Vierteljahr der Katastrophe im öffentlichen Leben geändert hat. Diesem „strukturellen Daten und Auswirkungen im Bereich der Gesellschaft“ kann ich beispielsweise entnehmen, dass die Arbeitslosenquote seit Jahresbeginn von 3,2 auf 5,1 Prozent im Mai gestiegen ist oder dass ich einer der 83 308 Münchner bin, die zur Risikogruppe gehören, weil sie älter als 80 Jahre sind.
Die Bilanz des Münchner Stadtmuseums ist eher optischer und haptischer Art. Zu sehen gibt es zum Beispiel  einen Corona-Hut Nicki Marquart mit einer Spannweite von 1,5 Metern. Gesammelt wurden aber vor allem Dokumente, die Bürgerinnen und Bürger, junge und alte, zum leidvollen Thema des Jahres eingeliefert haben. Da dominieren natürlich die oft komischen, liebevoll angefertigten Mundschutzmasken sowie die Fotos von der großen, ungewohnten Leere: auf Autobahnen, im Straßenbild, in Biergärten, auf dem Flughafen, im zunächst ausverkauftem Supermarkt. Polizisten mit Motorrädern kontrollieren ein einsames Pärchen im Englischen Garten. „Stop! Ausgangssperre. Tötliches Virus,“ plakatierte eine Steffi etwas fehlerhaft vor ihrer Behausung. Superoptimistisch verkündet jemand: „Ois werd guad.“
einen Corona-Hut Nicki Marquart mit einer Spannweite von 1,5 Metern. Gesammelt wurden aber vor allem Dokumente, die Bürgerinnen und Bürger, junge und alte, zum leidvollen Thema des Jahres eingeliefert haben. Da dominieren natürlich die oft komischen, liebevoll angefertigten Mundschutzmasken sowie die Fotos von der großen, ungewohnten Leere: auf Autobahnen, im Straßenbild, in Biergärten, auf dem Flughafen, im zunächst ausverkauftem Supermarkt. Polizisten mit Motorrädern kontrollieren ein einsames Pärchen im Englischen Garten. „Stop! Ausgangssperre. Tötliches Virus,“ plakatierte eine Steffi etwas fehlerhaft vor ihrer Behausung. Superoptimistisch verkündet jemand: „Ois werd guad.“
Dem Hin und Her bei den staatlich angeordneten Einschränkungen und Lockerungen für Kita- und Schulkinder begegnet die Stadt München mit einem schönen Programm. Anstelle des früheren Kinder-Kulturfestivals (KiKS) auf der Schwanthalerhöhe mit Massenbesuch wurden am vergangenen Wochenende an 80 Plätzen in verschiedenen Stadtteilen über 250 Angebote für die Sommerferien samt Stadtplänen und Spielmaterialien in Tüten verteilt. Verkauft wurden Karten für eintägige Erlebnisreisen. Obendrein können Jugendliche online über www.ak-kinderundjugendbeteiligung.de ihre Wünsche zur Freizeitgestaltung zur Kenntnis bringen.
29. Juni 2020
In allen acht städtischen Hallen- und Freibädern darf jetzt wieder geschwommen und geplanscht werden; auch Sauna und Fitness haben wieder auf, und sogar die Erdinger Thermen. Aber ach: Erst muss man online buchen, dann bekommt man per Mail einen QR-Code, der zum befristeten Besuch in einem bestimmten Bad berechtigt. Wie umständlich! Und derzeit auch unnötig. Denn direkt unter dem Volksbad lockt Münchens schönster Strand: eine täglich anders geformte Kiesbank mit Sträuchern, gefahrloser Strömung, spritzigem Wasserfall an der Schleuse, Steg für Schaulustige und nahem Biergarten, wo die Leute allerdings bis zum Bad hin anstehen. Mein Lieblings-Lido seit Jugendzeiten. Natürlich wird er in diesen Sonnentagen massenhaft genützt. Ein Schnappschuss zeigt, dass das Abstandsgebot durchaus eingehalten wird.
Die Krise hat natürlich auch die Medienwelt erschüttert und wohl nachhaltig verändert. Deshalb ein paar Worte in eigener Sache: Zwar ist die Nachfrage nach aktueller Information und damit die Anforderung an uns Zeilenschreiber deutlich gewachsen, gleichzeitig aber ist der existenzsichernde Anzeigenmarkt deutlich geschrumpft, so dass 14 bayerische Verlage Kurzarbeit anmelden mussten. Nicht wenige Redakteure wurden ins Homeoffice geschickt. Große Textteile der Blätter waren – und sind immer noch – allein vom Thema Corona blockiert. Pressekonferenzen und andere Veranstaltungen sind ausgefallen. Folge: Vielen freien, oft unterbezahlten Journalisten sind Themen und redaktionelle Aufträge weggebrochen. Ich kenne Kolleginnen, die sich deshalb einen neuen Job zum Beispiel in der Altenhilfe suchten.
Mit der Schreibmaschine aufgewachsener Digital-Azubi
Staatliche Soforthilfe greift eher selten. weil manche Freie keine eigene Betriebsstätte oder keinen „Liquiditätsengpass“ vorweisen können. Dazu kommt, dass in unserer Branche nun weniger von Mensch zu Mensch kommuniziert wird als vielmehr über allerlei neue Medien. Bisher traf man sich regelmäßig am Stammtisch oder bei einem Termin. Jetzt „traf“ ich zwei Mal Kolleginnen und Kollegen bei Video-Konferenzen, was für einen älteren, mit der Schreibmaschine aufgewachsenen Digital-Azubi gar nicht so einfach ist. Trotz Zoom konnte ich mich weder optisch noch akustisch ins Gespräch über Sozialfragen und über Pressefreiheit einbringen (beim nächsten Mal sollte es aber klappen).
Am gestrigen Sonntag interviewte mich ein aus NRW angereister Filmemacher. Er arbeitet an einer Dokumentation über Bruno Gröning, den ich im Juni 1949 in Herford als „Wunderdoktor“ entdeckt und dann  als Reporter der Abendzeitung jahrelang kritisch beobachtet hatte. In Krisenzeiten „wärmte man sich an Wahrsagern und Wunderheilern“, schrieb neulich der Historiker Norbert Frey in der Süddeutschen Zeitung und erwähnte den „Stanniolkugeln verteilenden Schreiner“.
als Reporter der Abendzeitung jahrelang kritisch beobachtet hatte. In Krisenzeiten „wärmte man sich an Wahrsagern und Wunderheilern“, schrieb neulich der Historiker Norbert Frey in der Süddeutschen Zeitung und erwähnte den „Stanniolkugeln verteilenden Schreiner“.
Auch die Autoren von Büchern rappeln sich wieder auf, nachdem sie wegen geschlossener Buchhandlungen und ausgefallenen Lesungen auf Verkäufe verzichten mussten. Die Stadt hat einen ihrer Läden im Rathaus-Parterre an sieben kleine Verlage günstig vermietet. Mindestens ein Jahr lang will der „Münchner Buchmacher“ ein literarisches Schaufenster und Verkaufsstandl der Stadt sein. Auch Vorträge und Lesungen sind vorgesehen. Für mich ein Lichtblick, nachdem die Vorstellung meiner Stadtchronik „Münchner Meilensteine“ dem Virus zum Opfer gefallen war. Kommunalreferentin Kristina Frank stellte in Aussicht, dass die Stadt noch weitere eigene Immobilien Künstlern zur Zwischennutzung bereitstellen wolle. Und Kulturreferent Anton Biebl verriet, dass sein Amt derzeit 14 000 Hilfsanträge aus dem Kulturbereich zu bearbeiten habe.
6. Juli 2020
„Masken ab!“ Je höher die Temperaturen steigen, desto lästiger wird der vorgeschriebene Mundschutz und desto lauter erflehen immer mehr Bürger oder ganze Gruppen, auch Prominenz darunter, ein schnelles Ende eben dieser Zwangsmaßnahme. Söder aber bleibt hart. Er fürchtet, dass die allgemein für Herbst erwartete zweite Infektwelle früher und heftiger kommen könnte. Er wird ja von Virologen beraten. Vielleicht genügt auch ein Blick in die Medizingeschichte. In Militärakten des Bayerischen Hauptstaatsarchivs zur Spanischen Grippe konnte ich bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit der heutigen Corona-Pandemie entdecken: Plötzlich, Ende August 1918, waren zunächst in den USA viele Neu-Infektionen gemeldet worden, nachdem das damalige Influenza-Virus bereits deutlich auf dem Rückzug war. Sein Stamm war nämlich mutiert, hatte sich nur ein wenig verändert. Und die Gegenmaßnahmen waren ebenso deutlich fast überall gelockert worden. In einigen Großstädten kam es zur öffentlichen Verbrennung der verhassten Masken. Die Schützengräben des noch flackernden Weltbrands boten diesbezüglich alles andere als Schutz. Mann auf Mann lagen auf beiden Seiten der Front. Im revolutionstrunkenen München wurden Soldaten als Pfleger in die Lazarette kommandiert.
In gewisser Hinsicht sind damit Szenen vergleichbar, die sich zurzeit hierorts an Sommerabenden abspielen. Besonders an drei beliebten und laufend beobachteten „Hotspots“ tobt ein Tänzchen auf dem Vulkan: An der  Isar zwischen Reichenbach- und Corneliusbrücke, auf dem Gärtnerplatz und rund um den Wedekindplatz, wo Ende Juni 1962 aus heiterem Himmel die „Schwabinger Krawalle“ begonnen hatten. Damals griff die Polizei sehr hart zu. Das wagt sie heute nicht mehr. Die strategischen Möglichkeiten, das Völkchen zur gebotenen Distanz untereinander und zum Vermummen anzuhalten, sind begrenzt. Ebenso ratlos wie die Ordnungshüter, stöhnen die jungen Leute, die sich zu lange schon eingeengt fühlen: „Wo sollen wir denn sonst hin?“
Isar zwischen Reichenbach- und Corneliusbrücke, auf dem Gärtnerplatz und rund um den Wedekindplatz, wo Ende Juni 1962 aus heiterem Himmel die „Schwabinger Krawalle“ begonnen hatten. Damals griff die Polizei sehr hart zu. Das wagt sie heute nicht mehr. Die strategischen Möglichkeiten, das Völkchen zur gebotenen Distanz untereinander und zum Vermummen anzuhalten, sind begrenzt. Ebenso ratlos wie die Ordnungshüter, stöhnen die jungen Leute, die sich zu lange schon eingeengt fühlen: „Wo sollen wir denn sonst hin?“
Einige Experten vermuten einen möglichen neuen Virenherd weniger in Open-Air-Milieus als in eher geschlossenen Orten der Geselligkeit, Musterbeispiel: das Tiroler Après-Ski-Eldorado Ischgl. Gemeint sind die immer noch geschlossenen Bars und Kneipen sowie die längst wieder offenen Biergärten und Restaurants. Nun hat Bayerns Wirtschaftsminister nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er ein Freund von Wirtschaften aller Art ist. Das weiß wenigstens die weiß-blaue Welt spätestens seit dem 25. Mai, als Hubert Aiwanger in schönstem Stoiber- oder Loriot-Stil der Presse klarmachte, wie viele „Kumpel“ mit einsfünfzig Abstand an einem bis zu 15 Meter langen Tisch beinander hocken dürfen.
Dieser Tage hat der Freie-Wähler-Führer sein Herz für die kleinen Wirtshäuser geöffnet, für die Kneipen, wie die Kumpels sagen, respektive für die Boazn, wie man in Altbayern sagt (anderswo wiederum kennt man dergleichen als Beisl, Pubs oder Bistros). Wieder dachte er vor Journalisten laut nach, als die Frage nach Wiederöffnung aufkam. Klar doch: „Je eher, desto besser“. Schnell aber wies, wieder mal, der fränkische Ministerpräsident Söder seinen niederbayerischen Stellvertreter Aiwanger in die Schranken: Klar, man könne auch über offene Schankwirtschaften reden, „aber nur nicht überstürzen“. So überstürzten sich also im bayerischen Corona-Kabinett die Ereignisse.
Auch eine Lockerung der Maskenpflicht lehnt Söder strikt ab. Auf die allgemeine Demaskierung, auf eine Art Befreiung, werden wir im Freistaat Bayern also wohl noch eine Weile warten müssen. Und wie lange auf die zweite Welle?
14. Juli 2020
Die Kinos dürfen nun auch in Bayern wieder spielen, das freut nicht nur die in München besonders zahlreihen Cineasten. Mich hat die flimmernde Leinwand, diese virtuelle Welt mit ihren Menschentypen, Landschaften und Fantasien, ein Leben lang begleitet und oft begeistert. Angefangen mit amerikanischen Importen, der Mickymaus und dem Kinderstar Shirley Temple, die auch die  humorlosen Nazis nicht verhindern konnten, über die Mach- und Schmachtwerke der UFA, mit denen uns die Kriegshetzer einlullten, danach mit Western, Krimis, Komödien, Katastrophenthriller. Bevorzugt: historische, literarische und biografische Stoffe sowie der Neue Deutsche Film. Etliche Stars und namhafte Filmmacher, das Schwabinger Junggenie Rainer Werner Fassbinder ebenso wie den Pasinger Porno-Produzenten Alois Brummer oder den französischen Naturforscher und -filmer Cousteau, konnte ich Interviewen.
humorlosen Nazis nicht verhindern konnten, über die Mach- und Schmachtwerke der UFA, mit denen uns die Kriegshetzer einlullten, danach mit Western, Krimis, Komödien, Katastrophenthriller. Bevorzugt: historische, literarische und biografische Stoffe sowie der Neue Deutsche Film. Etliche Stars und namhafte Filmmacher, das Schwabinger Junggenie Rainer Werner Fassbinder ebenso wie den Pasinger Porno-Produzenten Alois Brummer oder den französischen Naturforscher und -filmer Cousteau, konnte ich Interviewen.
Einer jener Erneuerer war es auch, der mich jetzt, gleich nach dem staatlich genehmigten „Klappe hoch“, in den Keller des Werkstattkinos lockte. „800 Mal einsam“ heißt der Filmneuling, der Edgar Reitz als Mensch und durch sein Lebenswerk würdigt. Eine Liebeserklärung an eine alte Kunst, die so oft totgesagt wurde, die aber auch Corona nicht sterben ließ. Allzu lange hat die Pause gedauert, in der das Publikum ausgeschlossen war. Die Kinobetreiber, echte Idealisten darunter, entließen ihre Angestellten in Kurzarbeit und bangten um ihre Existenz. Sie bangen noch.
Maskenpflicht (außer auf dem Sitzplatz), maximal 100 Zuschauer in Abständen von anderthalb Meter, also halbleere Säle, kontaktlose Ticketkontrolle, mehr Personal, größere Pausen zwischen den Vorstellungen, häufiges Öffnen der Türen zwecks Durchzug und Erfassung von Besucherdaten – von derlei hygienischen Vorschriften fühlen sich die Filmleute härter betroffen als die Betreiber von Bahnen und Flugzeugen. Geschäftlich kommt dazu, dass der lange Ersatz durch Streaming im Internet viele vom Kinobesuch entwöhnt haben könnte. Und dass Verleiher mit ihren teuren Produktionen zögern, zum Beispiel mit dem neuen James Bond: „Keine Zeit zu sterben“. Zwanzig Mitglieder der Münchner Art-House-Kinos drängen deshalb auf weitere Lockerungen.
Natürlich konnte es nicht ausbleiben, dass die neueste Weltkrise – wie früher schon Cholera und Ebola – selbst zum Filmthema wird. Doris Dörrie, die auch ein Corona-Tagebuch schreibt, hat vor der Filmhochschule zwei Telefonzellen aufgestellt, wo sich beliebige Leute fernmündlich, also ohne Körperkontakt, Geschichten über ihr Leben in der Pandemie erzählen können.
Vier Monate nach jenem „Schwarzen Freitag“, als die Aktienkurse in den Keller stürzten und Teile der Wirtschaft zu kollabieren drohten, ist wieder mal Zeit für eine Zwischenbilanz. Zum leichteren Merken etwas auf- oder abgerundet, sah die Covid-19-Statistik an diesem Wochenende seit Beginn der Pandemie so aus: 7000 Infizierte mit 220 Toten in München, 50 000 Erkrankte mit 2600 Toten in Bayern, 200 000 getestete Fälle mit 9000 Toten in Deutschland. Und weltweit wurde bisher das Leben von 570 000 Menschen – eine Stadt wie Dortmund – durch die Seuche ausgelöscht.
20. Juli 2020
Dass die Bayern gerne feiern, haben sogar so bedeutende Münchenbesucher wie Napoleon und Lenin bestätigt. Und alljährlich Millionen von Oktoberfestgästen. Leider ist das große, rauschige Nationalfest heuer einer Mikrobe zum Opfer gefallen, ebenso das Tollwood-Festival und die Dulten. Macht fast  nichts, es gibt jetzt Ersatz. Auf der so leeren Wiesn und einigen anderen schönen Stadtarenen und Höfen sollen von Ende Juli bis zum Ende der Sommerferien lauter kleine, alternative, kostengünstige Volksfeste improvisiert werden. Der Stadtrat und die darbenden Schausteller haben dem Projekt, das sich nun doch etwas verzögert hat, freudig bis begeistert zugestimmt.
nichts, es gibt jetzt Ersatz. Auf der so leeren Wiesn und einigen anderen schönen Stadtarenen und Höfen sollen von Ende Juli bis zum Ende der Sommerferien lauter kleine, alternative, kostengünstige Volksfeste improvisiert werden. Der Stadtrat und die darbenden Schausteller haben dem Projekt, das sich nun doch etwas verzögert hat, freudig bis begeistert zugestimmt.
„Sommer in der Stadt“ heißt – so wie ein Hit der Spider Murphy Gang - das umfangreiche Programm, das unter anderem der Festring München e.V. gemeinsam mit dem Bayerischen Trachtenverband organisiert. Ein dezentralisiertes Oktoberfest also: „Mit Tanz, Schuaplatterln und Goaßlschnalzen", so der Veranstalter Festring München. Ein Sommerfest mit komödiantischer Wanderbühne, vielen Standln, zwei Riesenrädern, Riesentrampolin, Karussells, Schaukeln, Kletterwand, Biker-Polo, Bier- und anderen Buden. Wie gewohnt also. Mit dabei sind weitere Vereine und Veranstalter sowie die Stadt selbst. Als Neuheit kreierte „Green City“ eine Mini-Oase: 70 Kubikmeter Sand wurden aufgeschüttet und ein paar Palmen in die Theresienwiese gerammt, rundum Liegestühle, Beachvolleyball- und Tennisplatz.
Soweit die eine, die helle Seite des bürgerlichen Lebens in der Corona-Zeit. Die andere, die Schattenseite, nehme ich durch telefonischen Kontakt mit zwei alten Freunden wahr. Beide heißen Hans. Beide leben in Pflegeheimen und fühlen sich dort einsam, sie sind regelrecht interniert. Der eine war einmal Stadtrat in München und leitete einen Dienstleistungsbereich. Der andere war Reisejournalist und Herausgeber eines in der Touristikbranche viel beachteten Informationsdienstes.
Hans B. haben die coronabedingten Einschränkungen vollends zermürbt, in Apathie und Depression fallen gelassen. Hans N. war in der Anfangszeit der Krise recht gelassen, fast fröhlich, er war ja gut versorgt und mit der übrigen Welt, die er so oft bereist und beschrieben hat, immer noch vernetzt; nämlich durch Kleincomputer und Internet. Das funktioniert nun nicht mehr - und ein Mechaniker darf nicht ins Heim. Alle leben dort in strenger Quarantäne. Das heißt, erst nach Anmeldung dürfen sie von einem – und zwar nur von einem - Angehörigen besucht werden, nicht länger als eine halbe Stunde und getrennt durch eine Glaswand. Seine Hausärztin darf überhaupt nicht kommen.
Die Zeit fließt träge dahin. Sämtliche Veranstaltungsprogramme, vom Gedächtnistraining bis zum Konzert, sind gestrichen. Noch mehr aber nervt den von Natur aus toleranten Traveller a.D., dass die Demenzpatienten im Haus ohne Schutzmaske rumlaufen. Man belehrt sie zwar immer wieder, aber es hilft kaum. Auch die Pflegekräfte sind längst mit ihrem Latein am Ende. Manche wohl auch mit ihrer Kraft oder gar mit dem guten Willen.
Dabei leiden alt gewordene Menschen anderswo noch um ein paar Grad mehr. Zum Beispiel in Mexiko (bisher über 35 000 Covid-19-Tote). Meine Schwester Irmgard darf in ihrem schönen Heim am Stadtrand mit überwiegend Deutsch sprechenden Bewohnern nicht mal von ihren eigenen drei Kindern besucht werden. Die Alten – sie sind die fast Vergessenen der großen Krise, über deren fatale Folgen man hierzulande am liebsten wegen der Erschwernisse und Belästigungen in Biergärten oder Unterhaltungsstätten lamentiert.
28. Juli 2020
Die Geselligkeit lässt zur Zeit doch sehr zu wünschen übrig. Nach längerem Stillhalten war ich mal wieder beim Verein der Rheinpfälzer in Bayern, der bisher immer sehr aktiv war. Kaum 20 Mitglieder wagten sich in den schönen Biergarten im Ostpark. Allgemeine Frage an den Vorsitzenden: Wann endlich geht es mit den Vortrags-, Ausflugs- und Wanderprogrammen weiter? (Ich hatte mich selbst auf eine Lesung und eine  Führung vorbereitet). Herr Müller wiegte den Kopf: Immer noch diese Probleme, Abstand halten und so ... Nicht wenige der 180 Mitglieder, überwiegend Rentner, haben ihn wissen lassen, dass sie immer noch - mehr oder weniger - Angst vor derartigen Zusammenkünften haben.
Führung vorbereitet). Herr Müller wiegte den Kopf: Immer noch diese Probleme, Abstand halten und so ... Nicht wenige der 180 Mitglieder, überwiegend Rentner, haben ihn wissen lassen, dass sie immer noch - mehr oder weniger - Angst vor derartigen Zusammenkünften haben.
Das Vereinsleben, das ja nicht ganz unwichtig ist im Dasein älterer oder einsamer Bürger, findet offenbar keinen Nährboden in dieser Zeit der Einschnürung. Wie lange soll das denn noch dauern? Eine Dauerfrage ohne Antwort. Vagen virologisch-politischen Prognosen folgend, richtet sich auch unser kleiner Verein erst mal auf den Herbst ein. Vielleicht kann dann wieder gemeinsam gewandert, eingekehrt und gebechert werden.
Manche Leute erwarten mehr Aktivität, mehr freie Freizeitgestaltung, auch erst zum Winter. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zum Beispiel, dem die Wirte sehr am Herzen liegen, denkt jetzt bereits an Weihnachten. Alles in seiner Macht stehende will der Freiwähler-Führer tun, damit heuer wieder die beliebten Traditionsmärkte stattfinden: vom weltberühmten Christkindlesmarkt in Nürnberg, wo Social Distance allerdings ganz unmöglich wäre, bis zum romantischen "Märchenbasar" in München. „Das wird wie Weihnachten", frohlockte jetzt schon mal Peter Bausch vom Verband der Schausteller und Marktkaufleute, als soeben der „Sommer in der Stadt“ quasi als Wies'n-Ersatz eröffnet wurde. (Siehe Tagebucheintrag vom 20. Juli)
Fast schon in Winterstimmung versetzt, höre ich aus dem Radio ein Interview mit dem Sprecher des Deutschen Skiverbandes. In dessen Vorstandssitzung ging es um die kommenden wintersportlichen Ereignisse. „Die ganze Woche, von Montagfrüh bis Freitagabend, sind wir mit Corona beschäftigt“, versichert der DSV-Mann. Besondere Sorge machen die Nordischen-Ski-Weltmeisterschaften, die Ende Februar 2021 in Oberstdorf beginnen und auch ein Jugendcamp bekommen sollen. “Hoffentlich wird diese WM wieder so, dass sie wenigstens ansatzweise den Begriff ,märchenhaft’ verdient.“ - Hoffentlich aber nicht wieder so märchenhaft, wie in der Ski-Hochburg Ischgl erlebt.
3. August 2020
Nach langer Zeit wieder mal ein Ausflug zur Alten Villa in Utting, wo einst an warmen Wochenenden der beste Dixilandjazz im Voralpenland gespielt wurde. Der Biergarten ist gut besetzt. Die Kastanien spenden immer noch Schatten. Nur die Musik ist verstummt. Der Mann am Steckerlfischgrill schnauzt mich an, weil ich das rotweiße Absperrband übersehe: „Kost mi a paar Tausender.“ Tatsächlich hat die Staatsregierung Verstöße gegen die Hygienevorschriften auf maximal 25.000 Euro erhöht. Die Brotzeitfräuleins aber sind sehr freundlich.
Von der Alten Villa zu den jungen Vitalen am Ammersee. Ich setze mich, mit Abstand, auf eine Bank neben eine alte Dame und ihre blutjunge Betreuerin. Belustigt betrachten wir alle das bunte Treiben am Ammerseestrand. Unbeschwert gibt sich das Völkchen, darunter wohl viele Ausflügler aus München und Augsburg, dem Sonnenbaden und Ballspielen hin. Kinder planschen im aufgeheizten See. Abstand ja, Maske nein.
„Mir schaffens scho,“ sagt plötzlich die freundliche alte Frau; es hört sich an wie das mutige Merkel-Motto auf Bairisch. Maria Marx, so heißt meine Nachbarin, meint ihr und unser gemeinsames Leben zur Corona-Zeit. Spontan fängt sie an, von noch schlimmeren Zeiten zu erzählen, von Ereignissen, die sie überstanden hat, etwa im Zweiten Weltkrieg. Lange vorher, als Finale der ersten Kriegs-Pandemie, hatte das kleine Utting, wo Maria 1921 geboren wurde, Auswirkungen der Spanischen Grippe erlebt.
Mit dem neuen Bähnle waren damals Badegäste aus der 40 Kilometer entfernten Großstadt Augsburg gekommen, wo Seuche und Tod umgingen. Sanitätsautos mit Grippeopfern – so kann man im bayerischen Militär-Archiv nachlesen - verstopften die Straßen; deshalb und wegen Benzinmangels kamen die Ärzte nicht zu den Kranken, die Stadt stellte Gutscheine für Kraftdroschken aus.
Unter den Stadtflüchtlingen war ein widerspenstiger Augsburger Abiturient mit seinen Freundinnen und Freunden. „Im bleichen Sommer“ des Grippejahres 1919 schrieb er eines seiner schönsten frühen Gedichte: „Vom Schwimmen in Flüssen und Seen“. Und 1929 kaufte er sich vom Dreigroschenoper-Ertrag in Utting ein Häuschen, dem er ebenfalls ein Gedicht widmete: „Sieben Wochen meines Lebens war ich reich.“ Danach kam er, so viel man weiß, nie wieder an den Ammersee. Ein Sträßchen trägt seinen Namen: Bert Brecht.
Maria Marx hat jahrzehntelang die örtliche Segelschule geleitet. Jetzt lebt sie in „im Austrag“ in einem alten Fischerhäuschen. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie in fünf Monaten – Corona hin, Corona her - ihren hundertsten Geburtstag noch erleben wird. Und zwar „g'sund“, wie sie hinzufügt. Sie verrät mir auch ihr Lebenselixier: „I hab net vui g'essen, war nia dick, und a weng gsportelt hab i aa.“ Direkt vor uns üben zwei Mädchen das Stehpaddeln.
Drei Tage vorher, ebenfalls 40 Kilometer Luftlinie entfernt, Presseclub am Marienplatz München: „So schön wars noch nie,“ zitiert Angela Inselkammer einen beliebigen Bayern-Besucher. Die Gastro-Präsidentin bekräftigt diese starke Aussage mit Hinweisen auf den „Sommer in der Stadt“, welcher mehrere, oft eher öde Plätze durch Standln und allerlei Gaudi befristet belebt und einige aufhübscht. Das Gespräch mit den Obersten des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands gilt eigentlich der Frage, ob wegen der Corona-Beschränkungen ein „Wirtshaussterben“ zu erwarten sei - das eh schon begonnen hat.
So schön? Nanu - wieder alles paletti? Schau'n wir mal. Tatsächlich brodelt und boomt da unten die gute Stube der Stadt. Shopping- und Schaulust fast wieder wie vordem. Scheinbar ziellos schlendern die Leute über den Marienplatz. Die meisten wahren den nötigen Abstand und lassen die Maske in der Tasche oder am Ohr baumeln. Sie starren hoch zum Glockenspiel am Rathaus, das aber stumm bleibt. Sie steigen eilig in die unterirdische Bahn. Sie lassen sich von Stadtführern beschwatzen. Sie kaufen und knipsen und konsumieren vor Buden oder Bierhäusern. Alles wie gehabt.
Auf den Bänken aus Blech aalen sich nicht nur müde, ältere Bürger. Menschen allen Alters, aller Geschlechter und offenbar auch wieder Besucher aus fernen Ländern blinzeln da in die Sonne des Münchner Sommers Einige blättern in Büchern oder Zeitungen. Aktuelle Fotos zeigen die nun auf Parkplätzen erlaubten „Freischankflächen.“ Dorthin und dahin hat sich also das „dolce far niente“ verlagert, zum „süßen Nichtstun“ muss man derzeit nicht unbedingt nach Italien reisen.
„Oh, wie schön ist München“, flötet die Schlagzeile des Lokalteils. Ein Blick jedoch auf die Frontseite desselben Leitmediums belehrt uns eines Besseren, das heißt Schlechteren. Die Hauptschlagzeile zitiert den deutschen Chefvirologen Lothar Wieler: „Die Entwicklung macht große Sorgen.“ Es folgen die neuesten Zahlen. In der Grafik dazu ist die rote Kurve der Neu-Infektionen in Deutschland wieder deutlich angestiegen, die im streng reglementierten Freistaat Bayern auch. An Begründungen mangelt es den Robert-Koch-Forschern nicht, sie müssten inzwischen jedem Mediennutzer hierzulande hinreichend bekannt sein. Am Samstag aber gibt die Süddeutsche noch einmal Zucker mit der Zeile: “So schön ist der Urlaub daheim.”
Viele Zitate – zwei Wahrheiten in dieser ungewissen neuen Zeit: Da der Schrecken – dort die Schönheit; da Lebensbedrohung – dort Lebenslust und Lebensbehauptung; da die Angst – dort Mut und Hoffnung.
10. August 2020
Sie können einem jetzt richtig leidtun, unsere Freunde und Helfer. Ich denke das mal ohne Häme, auch ohne großen Respekt vor hoheitlicher Gewalt. Was sich derzeit in manchen Großstädten tut, ist nicht mehr das seit den Schwabinger Krawallen gewohnte Katz-und-Maus-Spiel, sondern offene Konfrontation. Über die Ursachen dieser Entwicklung zerbrechen sich Psychologen, Soziologen, Polizeisprecher und Medienkommentatoren die Köpfe.
Unsere Polizei, das neue Feindbild? Berlin, Stuttgart und Frankfurt liegen zwar nicht in Bayern, doch auch hierzulande eskaliert ein gewisser, neuartiger Konflikt. Mindestens an regenfreien Wochenendabenden müssen i n München ganze Hundertschaften ausrücken, um Massen von Maskenverweigerern, vorgeblichen Grundrechte-Schützern, Krakeelern und als solche erkennbaren Provokateure, oft mit rechtsextremen Schreiern durchsetzt, bei elementarer Missachtung der Hygiene-Regeln aufzuklären, an den „Hotspots“ einigermaßen zu bändigen oder notfalls zu zerstreuen. Künftig sollen uniformierte Ordnungshüter auch noch Auslandsheimkehrer zum Corona-Test zwingen.
n München ganze Hundertschaften ausrücken, um Massen von Maskenverweigerern, vorgeblichen Grundrechte-Schützern, Krakeelern und als solche erkennbaren Provokateure, oft mit rechtsextremen Schreiern durchsetzt, bei elementarer Missachtung der Hygiene-Regeln aufzuklären, an den „Hotspots“ einigermaßen zu bändigen oder notfalls zu zerstreuen. Künftig sollen uniformierte Ordnungshüter auch noch Auslandsheimkehrer zum Corona-Test zwingen.
Das alles natürlich mit den beschränkten Mitteln der „Verhältnismäßigkeit“, die ihnen auch Gerichte immer öfter auferlegt. Wie denn nun? Mit höflichem Hinweis? Dann wird eine Polizistin schon mal blutig gebissen, wie in Landshut geschehen. Vielleicht mit Hausverbot wegen Beharren auf „Mundfreiheit“? Oder hilft schließlich nur noch das Wegtragen, wie in einem Günzburger Hotel geschehen? Der gut geschulte Polizeigriff, als „Achter“ bekannt, darf allenfalls bei Widerstand gegen die Staatsgewalt angewandt werden.
Nicht einfach auch, Gruppen von tausend oder mehr fröhlich feiernden Menschen „wegzusprechen“, wie Münchens Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins die Taktik Nr.1 benennt. Körperlichen Zwang? Die Polizeigewerkschaft hält es manchmal für nötig, Bayerns Innenminister, eigentlich einer harten Linie nicht abgeneigt, ist grundsätzlich dagegen. Zeitlich und örtlich begrenzte Aufenthalts- oder Alkoholverbote? Hat der Münchner Stadtrat abgelehnt; die CSU-Fraktion würde dem Party-Rummel lieber durch eine Aktion mit nett formulierten Postkarten begegnen.
Solche Ratlosigkeit frustriert - auch Teile der Polizei. „Es ist mehr als notwendig, der Bevölkerung eine klare Linie vorzugeben und diese Linie auch ebenso konsequent um- und durchzusetzen“, schrieb mir ein Beamter, den ich als freundlichen, historisch gebildeten Polizisten gut kenne. Die Polizei, klagt er, „wagt“ nicht zu agieren wie in den 60er Jahren. Insofern habe sich tatsächlich viel in der Ausbildung zum Positiven gewendet. Leider aber gleiche der Einsatz gegen die Corona-Leugner und der Party-Freaks oftmals einem Kampf gegen Windmühlen. Während sich die Polizei beim Bewältigen solcher Einsatzlagen weiterentwickelt habe, bleibe der Respekt gegenüber den Kollegen und das Verständnis für die nicht unberechtigten Vorgaben der Staatsregierung auf der Strecke.
Warum sich das Verhalten in Teilen der Gesellschaft dermaßen entwickelt hat, kann mein Polizist auch nur vermuten: Der gemeine Bürger denke: „Man liest nichts mehr, man sieht nichts mehr, man hört nichts mehr, man ist selbst bislang davongekommen - dann ist auch nichts mehr in Bezug auf Corona zu erwarten.“ Dieses Denken, gepaart mit der Rücksichtslosigkeit, Oberflächlichkeit und vor allem Dummheit Einzelner, werde noch Folgen haben.
Dem möchte ich nichts hinzufügen.
17. August 2020
Noch schnell ein paar Ferientage im Teutoburger Wald und in den reizvollen alten Städtchen am Rande des in Bayern wenig bekannten Mittelgebirges. Kein Corona-Hotspot weit und breit, kein gefährlicher Overtourism, aber Möglichkeiten zum Vergleich. Nordrhein-Westfalen scheint jetzt, nachdem die Infektionskurve stark angestiegen war, den Freistaat Bayern in der Hygiene-Politik überholen zu wollen. Keine Spur von „Lockerungen“, wie sie dem Landesvater Armin Laschet vorgeworfen wurden. Streng wird das Maskentragen und Abstandhalten in Bussen, Geschäften, Hotels, Museen und so weiter überwacht. Sogar beim Aufstieg zum Hermann-Denkmal werden Wanderern 150 Euro Bußgeld angedroht.
Natürlich trifft man auch hier, in Ostwestfalen, auf die üblichen Verweigerer oder Besserwisser. So mussten wir uns im wunderschönen Schwalenberg mit einem jüngeren, zunächst ganz vernünftigen Taxifahrer herumstreiten, der sich absolut nicht abfinden mag mit der vermeintlich von lügenhaften Medien manipulierten „Volksverdummung“. Seine Argumente: Zahlen von Grippeopfern in früheren Jahren („damals gab's noch mehr Tote“) und angebliche Meinungen von Medizinern.
In der Hauptstraße von Warburg, das sein Fachwerk und Bollwerk zauberhaft über die Hügel streut, sind zwei Schaufenster mit Kindermasken drapiert. Alle farbig, lustig, zierlich. In NRW müssen nämlich seit Ende der Ferien alle Schüler ab der fünften Klasse einen Mund-Nasen-Schutz anlegen und Abstand halten, nicht nur beim Betreten des Schulhauses oder beim Austreten, sondern dauerhaft auch im Klassenzimmer. Eine staatliche Bestimmung, die möglicherweise auch den Schulkindern in Bayern bevorsteht. Am 1. September will unsere Söder-Regierung darüber entscheiden, am 7. September wird es ernst.
Tausende von Lehrerinnen und Lehrern, von Müttern und Vätern bangen jetzt der Entscheidung entgegen. Manche mögen sich fragen: Wie bringt man kleine Kinder dazu, in einem geschlossenen Raum stundenlang Mund und Nase zu verhüllen? Meine nicht repräsentative Erkundung im Urlaubs- und Probe-Ort: Betroffene  stöhnen besonders wegen der Hitze im Gesicht, fügen sich aber ins Unvermeidliche, ältere Schüler natürlich eher als die jüngeren. Und eine Lehrerin klagt, sie müsse sich bemühen, fortan mit der Maske viel deutlicher und langsamer zu sprechen - und des gleichen ihren Schülern aufzuerlegen.
stöhnen besonders wegen der Hitze im Gesicht, fügen sich aber ins Unvermeidliche, ältere Schüler natürlich eher als die jüngeren. Und eine Lehrerin klagt, sie müsse sich bemühen, fortan mit der Maske viel deutlicher und langsamer zu sprechen - und des gleichen ihren Schülern aufzuerlegen.
Eine nicht ganz ernst gemeinte Anregung: Vielleicht ließe sich die Stimmung fördern, wenn man, die fröhlichen Angebote nützend, in den Unterricht eine Art Maskenfest mit Prämierung einspielen würde. Kleinere Kinder kennen so was vom Karneval respektive Fasching und vom Nikolaus. Dazu eine makabre Erinnerung: An einem 1. September vor langer Zeit machte man uns Fünftklässler in einem Münchner Waisenhaus mit dem Beginn eines Krieges vertraut, indem man uns diese seltsamen Gasmasken über den Kopf stülpte und Marsmännchen spielen ließ. Für Kinder kann Krisengeschehen auch komisch sein.
24. August 2020
Wie komisch Corona sein kann, konnte ich zufällig am Wochenende bei einem Ausflug an den Starnberger See wahrnehmen. Im Buchheimmuseum läuft (noch bis 11. Oktober) eine Ausstellung, die dem weltbekannten Cartoonisten Peter Gaymann gewidmet ist. Die Ausstellung „Virus Visionen“ wurde improvisiert, nachdem die zum 70. Geburtstag des Künstlers geplante Retrospektive samt Riesenparty der Pandemie zum Opfer gefallen war.
Seit Mitte März hat sich Gaymann, plötzlich isoliert, in seinem Atelier nahe dem Kloster Schäftlarn fast täglich mit einem „Trostpflaster“ beholfen, indem er einen witzigen Kommentar zur Krise aufs Papier warf. Die achtzig Aquarelle bespötteln so ziemlich alle Aspekte des pandemischen Geschehens: den Vorratskauf an  Klorollen ebenso wie das Maskentreiben, die Verschwörungsspinner ebenso wie die beschwerliche Kommunikation von Balkon zu Balkon („Immer auf den Abstand achten“).
Klorollen ebenso wie das Maskentreiben, die Verschwörungsspinner ebenso wie die beschwerliche Kommunikation von Balkon zu Balkon („Immer auf den Abstand achten“).
Ein Treppchen führt ins absonderliche Corona-Kabinett hinauf vom Hauptdeck des schiffartigen Museums, wo die großen Expressionisten des Gründervaters Lothar Günther Buchheim wieder mal neu gehängt sind (und die Bildlegenden auf dem Boden besser zu lesen sind als klein an der Wand). Und wo nebenan, auch noch bis Oktober, die vom Münchner Fernsehmacher Joseph Hierling gesammelten erstaunlichen Werke des deutschen „Expressiven Realismus“ die Entdeckung wert sind.
Es konnte ja nicht ausbleiben, dass Corona ein Thema der Kunst wurde. Das World Wide Web ist bereits voller Beispiele. Beliebtestes Motiv ist die Mona Lisa mit Maske – die weltberühmte Dame hat ja schon öfter zur Persiflage bei allerlei Ereignissen herhalten müssen. Und aus dem bekrönten Virus lässt sich allemal ein Schreckgespenstchen machen. Jetzt scheint die Corona-Kunst auch die Ausstellungshäuser zu infizieren. Und sogar den öffentlichen Verkehr. In Londoner U-Bahnen sollen Bilder des Streetart-Sprühers Bansky von Ratten – Gaymann lässt seine beliebten Hühner lästern - im Auftrag der Regierung an die seit Juli geltende Maskenpflicht erinnern.
31. August 2020
Die Kanzlerin hatte gewiss gute Gründe, in ihrem jüngsten Corona-Statement das Wohl und Wehe der Kinder an die Spitze zu rücken: Deren Bildung müsse „mit das Allerwichtigste sein“, sagte sie. Das klang fast so anspruchsvoll wie jener berühmte Satz, den Angela Merkel genau fünf Jahre zuvor auch vor der Presse gesprochen hat: „Wir schaffen das.“
Zeitgleich, zum Neustart der Kitas in Bayern im September, verkündete das Gesundheitsreferat der Stadt München einen konkreten, zwar etwas komplizierten Drei-Stufen-Plan, der eine Balance zwischen dem Bedarf an pädagogischer Betreuung und dem notwendigen Infektionsschutz herstellen soll. Eine Richtlinie für alle Kinderkrippen, Kindergärten, Horte, Tagesheime und Häuser für Kinder im Stadtgebiet.
Die systematische Bildung von Vorschulkindern ist immer noch ein umstrittenes Problem. Besonders in Bayern, wo einst regelrechte Kulturkämpfe um Kindergartenbusse und um die sogenannte christliche Gemeinschaftsschule geführt wurden. Kindertagesstätten gar galten vielen  Verantwortlichen als Teufelszeug aus der DDR. Da war natürlich Ideologie im Spiel. Mehrmals berichtete ich über Forschungen des Münchner Psychologie-Professors Heinz-Rolf Lückert über Möglichkeit und Notwendigkeit frühkindlicher intellektueller Bildung. Derlei Thesen stießen auf Widerspruch.
Verantwortlichen als Teufelszeug aus der DDR. Da war natürlich Ideologie im Spiel. Mehrmals berichtete ich über Forschungen des Münchner Psychologie-Professors Heinz-Rolf Lückert über Möglichkeit und Notwendigkeit frühkindlicher intellektueller Bildung. Derlei Thesen stießen auf Widerspruch.
Inzwischen sind die Kitas allgemein anerkannt - nicht nur als Aufbewahrungsanstalten für noch nicht schulpflichtige Kinder berufstätiger Eltern Doch die Pandemie hat nun wieder alles verändert. Inzwischen mehren sich Warnungen von Wissenschaftlern und Pädagogen, wonach längere Pausen oder Pannen bei außerhäuslicher Betreuung der Kinderseele extrem schaden; das Kuschelbedürfnis widerspricht den Abstandsgeboten. Dazu kommen erhebliche materielle Defizite.
"Es wird immer deutlicher, dass die Auswirkungen der Pandemie den Kindern mehr Schaden zufügen als die Krankheit selbst", warnt das Kinderhilfswerk der UN. Vermehrte Armut, Versorgungsengpässe und steigende Lebensmittelpreise führten zum Hungertod von mehr als 10 000 Kindern pro Monat. Bis Jahresende, so eine UN-Prognose, werden weltweit weitere 6,7 Millionen Mädchen und Jungen unter fünf Jahren von akuter Mangelernährung betroffen sein. Psychische Belastung und Bildungslücken wurden noch gar nicht abgeschätzt
Möge unseren Kindern erspart bleiben, was in anderen Ländern unvermeidlich erscheint. In Mexiko zum Beispiel, höre ich von meinen dortigen Angehörigen, finden Kindergarten und Schule weiterhin nur per Fernsehen und Radio statt. Aber nicht nur in ärmeren Ländern wäre regelmäßiger Milieuwechsel, wie ihn Kindertagesstätten bieten, von Nutzen für die frühkindliche Entwicklung. Dazu gehört nicht zuletzt das Zusammensein mit gleichaltrigen Spielgefährten.
7. September 2020
Die fortlaufenden Corona-Chroniken verschiedener Medien fesseln mich immer wieder. Sie lassen mich staunen und rätseln und rechnen. Sie bieten viel mehr als die übliche Information. Sie spiegeln ein farbiges Bild von einer persönlich miterlebten Krise, die so viele und ständig neue Facetten hat. Dabei konzentriere ich mich auf drei Quellen: die Süddeutsche Zeitung mit einer täglichen Sonderseite, die Apotheken-Umschau mit fast täglichen konkreten Ratschlägen und den Norddeutschen Rundfunk mit regelmäßigen Podcasts des Virologen Christian Drosten.
Unter „Wissen“ läuft die spezielle Corona-Folge der SZ. Ein Blatt voll farbiger Grafiken und aktueller Texte. Schwarz auf Weiß steht da zum Beispiel am 3. September 2020: „Die Mutation D614G, oder kurz G614, verändert möglicherweise die Zahl der Andockstellen auf dem Erreger und könnte damit eine Ansteckung begünstigen.“ Mit den Andockstellen sind die Zacken oder Krönchen gemeint, die der Sars-CoV-2-Mikrobe den Namen „Corona“ (Krone) geben. Jenseits solcher Satzungeheuer erfährt der Leser durchaus Neues aus der Forschung zum ungeklärten Virus-Problem, die nach übereinstimmenden Berichten „fieberhaft“ betrieben wird, und zwar überall in der Welt.
Wie es auf der Welt draußen und zuhause mit der täglichen Ausbreitung der Infektionen momentan aussieht, lässt sich indes aus den vielen Kurven und Statistiken leichter erkunden als aus manchen wissenschaftlich fundierten Texten. Doch auch hier wundert sich der verunsicherte Leser. Etwa darüber, dass sich die Zahlen des Robert-Koch-Instituts und des bayerischen Gesundheitsamtes deutlich unterscheiden. Dass die Städte Landshut, Ingolstadt und Memmingen plötzlich den als gefährlich geltenden Wert überschritten haben. Dass sich auch München an diesem Wochenende der Alarmstufe 1 nähert, Dass Laschets Land bei der Gesamtzahl der Infizierten das Söder-Land überholt hat. Dass Indien die USA überholt hat. Dass Deutschland und Italien jetzt gleichauf liegen. Und so weiter. Ein Wechsle-das-Bäumchen-Spiel, nur weniger lustig. Mehr Fragen als Klarheit.
Sehr viel praktischer informiert mich zur gleichen Zeit der Online-Dienst der Apotheken-Umschau. Spätestens nach drei bis vier Stunden Tragezeit sollte die Maske getauscht werden, rät ein Virologe. Sie könnte auch, einer Studie zufolge, nach einmaliger Benutzung bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Allerdings bieten „einfache Alltagsmasken“ keinen nachgewiesenen Schutz gegen das Virus, dienten aber als „Barriere für den Tröpfchenauswurf des Maskenträgers“ und könnten somit die Gefahr einer Übertragung „zumindest ein Stück weit verringern“.
Nicht sehr zuversichtlicher stimmt mich auch der Chef-Virologe Christian Drosten, dessen Berliner Charité eine Art Andockstelle für aktuelle globale Medizinrätsel geworden scheint. Die Infektionshäufigkeit werde aus unterschiedlichen Gründen unterschätzt, stellte er zum Start seiner neuen Podcast-Serie fest. Viele junge Leute würden ihre meist harmlosen Symptome verstecken, um nicht diagnostiziert zu werden. „Wenn ich auf 'ner illegalen Techno-Party war, dann hab‘ ich ja noch mehr die Tendenz“, meinte Drosten verständnisvoll. Trotzdem meint er jetzt, dass fünf statt bisher 14 Tage Quarantäne genügen könnten.
Auch die Süddeutsche zitiert oft und gern den 48-jährigen Berliner Virenpapst. Und fand es einmal angemessen, ihn als „Posterboy der Stunde“ zu porträtieren. Insbesondere von dessen „geradezu spitzbübischer“ Haartracht schien die Stil-Beschreiberin entzückt zu sein. „Seit Wochen hängen wir an seinen sinnlichen Lippen“, hieß es in dem feuilletonistischen Fauxpas. Wobei noch anzumerken wäre, dass Christian Drosten von Corona-Leugnern mit Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen bombardiert wird. Auch das gehört zum Spiegel einer Pandemie.
14. September 2020
München müsste jetzt eigentlich voll sein. Jeweils 6,3 Millionen Gäste waren in den beiden Jahren vor Corona zum Oktoberfest schon Mitte September gekommen, hatten alle Hotels und Restaurants gefüllt und die Stadt um einige Millionen Euro bereichert. Wie wird sie nun dastehen - nach dem Einbruch, den die Absage des weltgrößten Volksfestes erzwang? Wie wird sich der durch die Pandemie gebotene Verzicht, der nicht nur einen wirtschaftlichen Ausfall bringt, langfristig auswirken?
„Die Reiselust ist ungebrochen.“ Oft habe ich diesen Satz in den vergangenen Jahrzehnten gelesen oder – als Reisejournalist – selbst geschrieben. Noch keine Krise hat den deutschen und internationalen Tourismus auf Dauer gelähmt, immer mehr und immer wieder hat sich das Reisen zum Zweck der Erholung oder Bildung als ein Grundbedürfnis des heutigen Menschen erwiesen, vergleichbar dem Bedürfnis nach Arbeit und Obdach.
Anfang der 90er-Jahre zum Beispiel hatten Terroraktionen, Bürgerkriege, Naturkatastrophen und auch Seuchen (Ebola) klassische Reiseziele in aller Welt gefährdet. Im bayerischen Fremdenverkehr indes schlugen  damals andere Entwicklungen zu Buche: Rezessionen in Nachbarländern, der Abzug von NATO-Truppen und ganz besonders die – im Ausland mit Sorge beobachteten – Umtriebe von Neonazis.
damals andere Entwicklungen zu Buche: Rezessionen in Nachbarländern, der Abzug von NATO-Truppen und ganz besonders die – im Ausland mit Sorge beobachteten – Umtriebe von Neonazis.
Wohl aus diesen Gründen wurden im Jahr 1993 in München, dem mit 1,3 Millionen Ankünften führenden Reiseziel, immerhin 6,6 Prozent weniger Gäste registriert, die Ankünfte aus dem Ausland brachen sogar um 11,3 Prozent ein. Augsburg führte sein Minus von 9,4 Prozent ausdrücklich auf „ausländerfeindliche Ausschreitungen“ zurück. Und auch Nürnberg meldete einen „nie dagewesenen Tiefstand“. Dann kam die globale Verunsicherung nach dem Terror-GAU vom 11.9.2011.
Und dann kam Corona: Wie wirkt sich die Pandemie auf den heimischen Tourismus aus? Da aus klassischen europäischen Urlaubsgebieten, etwa in Spanien und Kroatien, plötzlich wieder hohe Infektionsraten gemeldet wurden, konnten die heimischen Touristik-Anbieter eine Wiederbelebung erwarten. Einer vermeintlichen Trendumkehr wurde auch schnell Nachdruck verliehen durch Parolen wie „Urlaub dahoam“ oder – so der Seniorenbeirat der Stadt München - „Nichts wie raus“.
Dies führte zwar zu einer gewissen Entlastung der Städte, aber auch zu einer Belastung anderer Orte und Regionen. Die neue Massenwanderung von Ausflüglern und Feriengästen hin zu den eh beliebtesten Zielen im Alpenvorland trieb viele Einheimische auf die Palme. Plakataktionen in einigen Seegemeinden wirkten indes so unsympathisch und unsolidarisch, dass andere Bürgergruppen die „lieben Münchner“ nun wiederum umwarben. Wohl auch mit Blick auf bessere Zeiten.
Indes herrscht in großen Teilen Bayerns weiterhin Ruhe, bedingt durch Corona. Das erlebte ich sogar in den attraktiven Städtchen entlang der Romantischen Straße; hier fehlen halt die Traditionsgäste, die Japaner.
In den Großstädten ist der einträgliche Messe- und Geschäftsreiseverkehr total eingebrochen. Daher lag die Zahl der Übernachtungen in München während der eigentlichen Hochsaison um 35 Prozent und die der gemeldeten Ankünfte sogar um 77 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahresstand. Die früher dominierenden Amerikaner bleiben fast ganz aus. Nur aus den Nachbarländern zeigt sich zaghaft eine Wiederbelegung an. Noch aber hat Münchens touristischer Hotspot, das Platzl, seine gewohnte Geschäftigkeit nicht zurückgewonnen. Leer sind die Souvenirshops, halbleer die Hallen des Hofbräuhauses, wo schon am Eingang eine Wand voller Warnungen und Verhaltensanweisungen eher abschreckt als zur legendären Gemütlichkeit einlädt.
21. September 2020
In jener Zeit, als rebellisch gewordene Stadtbürger gegen den Kapitalismus kämpften, widersetzte sich die ideologisch stramme SPD-Sektion Altstadt-Lehel hartnäckig der am idyllischen Thierschplatz geplanten U-Bahn-Station. Begründung: Dadurch wäre dort Wildwuchs von Konsum und Kommerz zu erwarten. Ganz so schlimm ist es dann, wie oft bei derlei Ängsten, doch nicht gekommen.
Vier Locations für Speis und Trank und Z'ammhocken sind es dann geworden, alle direkt am U-Bahn-Ausgang Ost, alle mit exotischen Namen und Angeboten. Das hat einen kosmopolitischen, um nicht zu sagen komischen Flair in unser braves Vorstädtchen gezaubert. Gottlob blieb, einen Steinwurf entfernt, der Tattenbachhof erhalten, in dessen „Altdeutscher Weinstube“ einst Chorsänger der Staatsoper nach der Vorstellung ihre Gesangskünste solo und gratis dargeboten hatten.
Am 15. März 2020 war Schluss mit Essen und Trinken und mit lustig erst recht. Am Thierschplatz hatte wochenlang nur noch die systemrelevante Apotheke auf, und der 115 Jahre alte Schnitterin- Brunnen plätscherte ungehemmt weiter. Langsam aber hob sich Corona-Söders Eiserner Vorhang. Erst öffneten wieder der Italiener Pepenero und der Inder Sitar, beide reklamierten noch einige der eh ungeliebten Parkplätze als Freischrankflächen hinzu.
Brunnen plätscherte ungehemmt weiter. Langsam aber hob sich Corona-Söders Eiserner Vorhang. Erst öffneten wieder der Italiener Pepenero und der Inder Sitar, beide reklamierten noch einige der eh ungeliebten Parkplätze als Freischrankflächen hinzu.
Am 18. Mai wurden sämtliche Freischankflächen Bayerns, Biergärten inklusive, wieder freigegeben. So durfte auch das Ca Ba Lu seine Tische und Stühle erneut neben die U-Bahn-Rolltreppe stellen. Obwohl Kneipen wie eben diese noch gar nicht an der Reihe waren. Doch der clevere Jungwirt, den die Gäste nur als Mike kennen, drängelte sich flugs in die bevorzugte Abteilung Restaurant, indem er Snacks zu seinen Cocktails servierte, und zwar die „Best Burgers in Town“.
Obendrein könnte die kleine Kneipe mit einem Traditiönchen locken, so es denn das aktuelle Jungvolk interessieren würde. Haus Nr. 5 am Thierschplatz war nämlich in den fröhlichen 1970er-Jahren ein Ort, den man heute Hotspot nennen würde. In der ersten Helmut-Dietl.-Serie „Münchner Gschichten“ hatte Charly Häusler, der windige Stenz vom Lechl, seine Oma dort ausquartiert, nach Neu-Perlach, um ihre Wohnung in einen Shop zu verwandeln: „Tscharlies Tscchiens“.
Seit diesem Wochenende nun stehen auch die speiselosen Bars auf dem staatlichen Phasenplan. Deshalb durfte auch der Nachbarladen den Vollbetrieb wieder aufnehmen. Eigentlich wollten Joe und Ashni den Neustart laut Aushang mit einer „Big Party“ feiern. Wegen der neuen Viren-Welle begnügten sie sich spontan mit „Soft Opening Hours“ für Stammgäste („Famiglia“) und andere - „vom Studenten über den Bauarbeiter bis hin zum Anzugträger“. Natürlich achten die beiden „Baristen“, wie sie sich bezeichnen, ganz streng auf Masken und Abstände zwischen den Hockern rund um den Tresen. Diese Bar hat gleich zwei fremdartige Namen: „Celento & Stenz“ sowie „Bussi Uschi“. Mit dem einen sollen Mittagsgäste angesprochen werden, mit dem anderen junge Nachtschwärmer.
Jetzt warten nur noch die Betreiber von Clubs und Discos auf das erlösende Wort aus der Staatskanzlei. Die Zeit drängt, Freischankflächen sind bald nicht mehr gefragt. „Winter is coming“, sinnierte der Landesvater. „Nur Alkohol, keine Speisen, unglaublich laute Musik, Singen, Schreien im Zweifelsfall, auf engstem Raum – große Vorsicht und Vernunft sind da sicher nur ganz schwer durchsetzbar.“ Wirte, wartet noch ein Weilchen, will Söder wohl sagen. Aber wie tröstet sich doch der Monaco Franze, ein anderer Dietl-Held, in der vollen Tanzbar: „A bisserl was geht immer.“
28. September 2020
An der Glastür zu meiner Bankfiliale fängt mich am Donnerstag ein Herr im schwarzen Anzug ab und hält mir ein Gerät an die Schläfe, das aussieht wie ein schwerer amerikanischer Colt. Es soll Corona-Keime aufspüren. Erst als der Colt bestätigt, dass ich fieberfrei bin, darf ich Geld abheben. Diese Prozedur gehört wohl zu den neuesten, abermals verschärften Hygiene-Maßnahmen, die quasi über Nacht - behördlich oder privat - in München und anderswo eingeführt wurden.
Warum wohl? Am Wochenende davor wollte ich mir draußen in der Innenstadt die „Wirtshaus-Wiesn“ anschauen, mit der bekümmerte Großgastronomen ihre existenziellen Nöte ein wenig vergessen sowie den Münchnern wenigstens einen Hauch von Oktoberfeststimmung zufächeln wollten. Was ich sah, war ein einziger Biergarten zwischen Platzl und Viktualienmarkt. Überall wurde „O'zapft“, auf allen Straßen und Plätzen ein Gewimmel von Wiesn-Süchtigen mit Entzugserscheinungen, jede Menge Dirndl und Lederhosen, Straßenmusik. Masken? Auch, aber längst nicht überall. Abstand? Eher selten. Fehlte nur das Schunkeln und Tanzen auf Tischen. Im schönen Hof des Hofbräuhauses fand ich keinen Platz. Und Stattreisenführer Max, der für die bevorstehende Migranten-Tour einen Meterstab zur Abstandsmessung mitführt, wartete vergebens aufs Essen.
Alles schön und gut. Doch eigentlich konnte ein solcher Rummel nicht gutgehen. Das argwöhnten einige Stadträte und sogar eine Minderheit der darüber abstimmenden Wirte. "Sehr verstörend" empfand dies Treiben unser Landesvater, der ja nicht im feiernarrischen München zu Hause ist, sondern im eher nüchternen Nürnberg. Einerseits sei es schön, Lebensfreude und Brauchtum zu sehen, sinnierte Söder, andererseits seien die Bilder vom Viktualienmarkt und anderen Plätzen „Anlass zu großer Sorge".
Nicht zuletzt solche "Bilder" und die Einschätzung, dass an diversen öffentlichen Stellen keinerlei Schutzmaßnahmen eingehalten wurden, veranlassten Oberbürgermeister Dieter Reiter am vergangenen Montag zur Entscheidung, die Regeln zu verschärfen. Das heißt: Auf allen notorisch belebten Plätzen der City und deren Zulaufstraßen herrscht Maskenpflicht – ein Wort, das unsereinen an Faschingsbälle früherer Zeiten erinnert. Viele Passanten, auch die uninformierten, halten sich daran. Warum aber gilt das Maskengebot nicht auch für das immer bevölkerte Platzl und im Tal nur auf den Gehsteigen? Dass obendrein Verbote für Verkauf und Verbrauch von Alkohol für ganz bestimmte Zeiten erlassen wurden, gehört zu den Ungereimtheiten und mehrt die Unlust.
Die mit Bußgeld bewehrte Schockstarre, die zweite nach dem Lockdown, sollte zunächst für sieben Tage gelten. Und was dann? Hängt ganz von den Fallzahlen ab. Auf jeden Fall wird nun Verzicht verlangt von uns eh schon gebeutelten Bürgern. Nicht mehr nur auf Ersatz-Oktoberfeste und ähnliche  Pseudo-Gaudi sollen wir verzichten, sondern auch auf andere Gewohnheiten. Zum Beispiel auf das öffentliche „Zammahocken“ von mehr als fünf „Kumpeln“ (Hubert Aiwanger). Oder auf die eine oder andere Herbstreise ins Ausland. Denn die Bundesregierung hat nicht weniger als 14 EU-Länder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen.
Pseudo-Gaudi sollen wir verzichten, sondern auch auf andere Gewohnheiten. Zum Beispiel auf das öffentliche „Zammahocken“ von mehr als fünf „Kumpeln“ (Hubert Aiwanger). Oder auf die eine oder andere Herbstreise ins Ausland. Denn die Bundesregierung hat nicht weniger als 14 EU-Länder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen.
Gestrichen habe ich auch die geplante Bahnreise nach Forchtenberg, wo Sophie Scholl vor bald 100 Jahren geboren wurde. Das Städtchen, in dem mich der Weiße-Rose-Pfad interessieren würde, liegt nämlich knapp in Württemberg, und die Stuttgarter Regierung hat ausdrücklich „untersagt, in Beherbergungsbetrieben Gäste zu beherbergen, die sich in einem Land-, Stadtkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten oder darin ihren Wohnsitz haben, in dem der Schwellenwert von 50 überschritten wird“. In München schlug die Alarmglocke, als vergangenen Mittwoch 55,93 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen gemeldet wurden. Mittlerweile ist der Wert zum Glück wieder signifikant gesunken.
Einen Wiesn-Ersatz ganz anderer Art bietet die Villa Stuck. Der vielfach preisgekrönte Medienkünstler Philip Gröning hat in diesem städtischen Avantgarde-Museum ein „Phantom Oktoberfest“ installiert. In einem total dunklen Raum bekommt man von Leuten in Schutzanzügen ein Headset aufgesetzt – und man befindet sich plötzlich in einem virtuellen Bierzelt. Um einen flackern Lichter, bewegen sich Gestalten, tönen Musikfetzen und die dort üblichen Geräusche. Wer das Projekt voll erfassen will, muss allerdings versuchen, tiefer in den geistigen Überbau einzudringen, in die Scheinwelt des Instagram, des Selfies und der künstlichen Intelligenz, die Gröning „durch den Zufall von Corona“ widerspiegeln.
5. Oktober 2020
„Winter is coming“ stand auf einer Tasse, die Bayerns Regierungs- und CSU-Chef auf einem Parteitag  den Kameras präsentierte. Derweil warnte der deutsche Gesundheitsminister radikal und ausnahmslos vor Auslandsreisen in den Herbst- und Winterferien. Und unsere oberste Krisenmanagerin nannte das, was auf uns alle zukommt, in ihrer einfachen, aber eindringlichen Sprache „eine schwierige Zeit“. Grippezeit, Virenzeit, Coronazeit nächste Folge. Und höchste Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
den Kameras präsentierte. Derweil warnte der deutsche Gesundheitsminister radikal und ausnahmslos vor Auslandsreisen in den Herbst- und Winterferien. Und unsere oberste Krisenmanagerin nannte das, was auf uns alle zukommt, in ihrer einfachen, aber eindringlichen Sprache „eine schwierige Zeit“. Grippezeit, Virenzeit, Coronazeit nächste Folge. Und höchste Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Tatsächlich haben sich Politiker, Planer und Geschäftemacher längst auf einen Winter des Missvergnügens vorbereitet. Markus Söder zum Beispiel rückte, als die Sonne noch glühte, die Weihnachtsmärkte mit ihren allzeit umlagerten Glühwein-Standln ins Visier. Einfach ausfallen lassen wie dieses Weltvolksfest in München? Auf keinen Fall, beharren Betreiber und Behörden unisono – und die Traditionsträger sowieso. Söder, dessen Heimatstadt Nürnberg ja die Mutter aller Christkindlmärkte beherbergt, weiß schon mal einen Ausweg: Laufstege. Der Vorschlag soll wohl dem Gegeneinanderlaufen von Menschenmassen durch Einbahnen vorbeugen.
Indessen überlegen die Gastwirte, die nach wie vor zu den Hauptkrisenopfern gehören, wie sie dem drohenden Schlamassel ein weiteres Mal entkommen können. Immerhin haben sie mit behördlich geduldeten Freischankflächen und der gut organisierten, soeben beendeten „WirtshausWiesn“ die Saison in den warmen Wochen noch halbwegs gerettet. Für die kältere Jahreszeit können die Gastronomen aber das Merkel-Motto „Wir schaffen das“ noch kaum bestätigen.
Keine schlechte Idee ist, die auf Parkplätzen usurpierten „Schani-Gärten“ in angewärmtem Zustand weiter zu betreiben. Dies soll nun durch Heizpilze und vielleicht auch Überdachung geschehen. Das ist teuer und alles andere als ein Beitrag zum Energiesparen. Trotzdem haben fast alle Fraktionen des Stadtrats eine solche Hilfsaktion befristet gebilligt - auch wenn die Grüne Gudrun Lux etwa eine Beheizung der Stadtluft durch Ökostrom „noch uncool“ fand. Das Verbrennen von Holzkohle erzielt hier leider nicht den gleichen Effekt wie bei gebrannten Mandeln oder heißen Maroni, was so manche Weihnachtsbuden wärmt.
Auch die an Wachstum gewöhnte Touristikbranche hat sich für eine halbwegs gute Wintererholung gerüstet. Die Zahl der Kataloge des Münchner Veranstalters Studiosus ist um gut die Hälfte geschrumpft, viele beliebte Ziele wurden gestrichen. Bayern darf hoffen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der auch für den Fremdenverkehr zuständig ist, verbreitete mit in seiner einfachen, aber eigenwilligen Sprache wieder mal Optimismus: „Wintersport ist in diesem Jahr auf jeden Fall verantwortbar.“ Die Nase vorn hat aber wieder mal Europas führendes Winterurlaubsland Österreich, speziell unser Nachbar Tirol.
In der U-Bahn-Station empfängt mich ein Riesenplakat mit der frechen Frage: „Wir sind bereit. Und du?“ Gemeint ist der Saisonstart eines Gletscherskigebiets. Die Werbung kommt aus jenem Land, das ein europäischer Startplatz der Seuche war. Zugegeben, es war nicht Hintertux, sondern Ischgl, dessen Ruf als wintertouristischen Hotspot ich selbst einmal als Reisejournalist gefördert habe. Weihnachten 1978 etwa mit einer Reportage über diese neue „europäische Attraktion“. Später habe ich den Ski-Wahn meines immer noch liebsten Alpenlandes eher kritisch beleuchtet, mit Schlagzeilen wie „Tirol treibt's immer toller“ oder „Ganz Tirol ein Skizirkus“.
Publicity dieser Art gefällt den Verantwortlichen jetzt überhaupt nicht mehr. Dass die Berliner Institutionen das Bundesland Tirol komplett als Corona-Risikogebiet eingestuft haben, beklagte Landeshauptmann Günther Platter als „schweren Schlag für unseren Wirtschaftsstandort, unseren Arbeitsmarkt und ganz Tirol". Stimmt wohl auch: 52 Prozent aller Übernachtungen in Tirol entfallen auf deutsche Gäste. „Unfair“ nannte der Tourismusverband Ischgl den bayerischen Landeschef. Er ziehe das Dorf bei jeder Gelegenheit zu Vergleichen heran. Deshalb wurde Herr Söder zu einem persönlichen Vergleich eingeladen. Après-Ski alter Art würde Söder, falls er denn käme, aber wohl kaum geboten.
12. Oktober 2020
Seit Wochen beherrscht das Ach und Weh, aber auch die Wehrhaftigkeit von Gastwirten, Kulturträgern, Kita-Betreuern und anderen Corona-Betroffenen die Berichterstattung in München. Das ausgefallene, klein kopierte Jubel- und Trubelfest hat den allgemeinen Jammer auf die Spitze getrieben. Auch ich habe auf diesen Seiten eingestimmt in den großen Klagechor, der das Schicksal der eigentlich Leidtragenden ziemlich übertönt hat. Deshalb mache ich mich auf den Weg ins Klinikum rechts der Isar (MRI).
Den Infektiologen Christoph Spinner will ich fragen, wie es seinen Covid-19-Patienten geht. Infektiologen, erfuhr ich zum etwaigen Vergleich mit Ärzten wie Christian Drosten, arbeiten mehr am Menschen, Virologen mehr im Labor. Der Zutritt zum Klinikum gleicht dem zu einem Hochsicherheitstrakt. Ich werde durch markierte Gänge geschleust wie am Flughafenschalter, muss einen langen Fragebogen ausfüllen wie beim Facharzt, werde von einem Gerät auf Körpertemperatur gemessen - und muss warten. Eine Prozedur, der aktuell jeder Besucher unterworfen ist.
Derzeit liegen nur noch fünf Covid-19-Patienten im MRI. Der Rückgang hat mehrere Gründe, die mir Oberarzt Spinner erläutert: „Erstens wurden zuletzt vorwiegend jüngere Leute mit schwächeren Symptomen stationär aufgenommen und bald wieder entlassen. Zweitens konnten mit dem  Therapeutikum Remdesivir, das auch dem US-Präsidenten Trump verabreicht wurde, in Studien gezeigt werden, dass die Aufenthaltsdauer um 31 Prozent verkürzt werden konnte. Drittens hat sich das Vorsichtsbewusstsein der deutschen Bevölkerung deutlich verstärkt.“
Therapeutikum Remdesivir, das auch dem US-Präsidenten Trump verabreicht wurde, in Studien gezeigt werden, dass die Aufenthaltsdauer um 31 Prozent verkürzt werden konnte. Drittens hat sich das Vorsichtsbewusstsein der deutschen Bevölkerung deutlich verstärkt.“
Trotz einer gewissen Entspannung müssen noch zwei Patienten intensiv behandelt und künstlich beatmet werden, einer wegen schwerer Lungenentzündung sogar mit der Herz-Lungen-Maschine. Lebensgefahr. Auch eine noch so intensive Behandlung lässt nicht jeden Schwerkranken überleben. Bisher sind in München immerhin 229 Menschen der Seuche zum Opfer gefallen, etwas weniger als in den größeren Städten Berlin und Hamburg.
Und an dieser Stelle sei ein Indiz angeführt dafür, dass Corona auch im Reich der Toten mitregiert: Ich wollte eine Führung im Alten Nördlichen Friedhof buchen. Von der Volkshochschule wurde ich zur Bekanntgabe aller möglichen Daten einschließlich Bankverbindung aufgefordert. So wird halt alles immer komplizierter. Ich habe auf die Friedhofsrunde verzichtet.
19. Oktober 2020
Wer leidet denn nun – abgesehen von den Virus-Kranken – am meisten an der schon so lange andauernden Pandemie? Sind es die Wirte oder die freischaffenden Künstler in ihren wirtschaftlichen Nöten? Oder die Politiker, die tagtäglich neue, unpopuläre Entscheidungen abwägen und treffen müssen? Oder die hart geforderten Frauen und Männer im Dienst um unsere Gesundheit? Ich würde bei der Frage nach den besonders Belasteten eher auf jene Menschen tippen, die keine laute Lobby haben und daher weniger Aufmerksamkeit genießen: die ganz ganz Alten. Eben lese ich in der Abendzeitung auf Seite 1: „Es trifft vor allem Ältere in Städten. Forscher warnen, Seelsorger schlagen Alarm.“
Beim Versuch, diese Feststellung und meine Vermutung bei befreundeten Altersgenossen zu verifizieren, erlebe ich jedoch eine Überraschung. Hans Nechleba, 84 Jahre alt, ehemals Reisejournalist, hatte anfangs verständliche Klagen über seine virus-bedingte Internierung in Obermenzing. Doch inzwischen hat er sich daran gewöhnt, nachdem er in seinem Heim wieder Angehörige sehen darf. Allerdings nur hinter Plexiglas, nach Anmeldung und zeitlich begrenzt. Andererseits: „Die Pflegerinnen sind sehr freundlich geworden und erfüllen mir manchen Wunsch, besorgen mir beispielsweise Bücher. Ich schau mir halt jetzt die Welt in Büchern an.“ Mit einer Ärztin aus Kairo unterhält er sich auf Arabisch, das er ständig aufbessert. „Du ahnt gar nicht, wie viel Freude einem so was bringt.“
Einen anderen alten Bekannten, der seine Agentur „Cinepress“ mal in meinem Haus hatte, erreiche ich in einem Seniorenheim in Erding. Ich gratuliere ihm telefonisch: zum 100. Geburtstag. Eingeladen dazu hatte er, Peter Kühn, den Bürgermeister und andere Ortsprominenz mit der Verlockung: „Time to drink champagne and dance on the table.“ Gefeiert, wenn auch nicht auf dem Tisch getanzt, wurde in der Therme, die als “größtes Thermalbad der Welt” wirbt und wieder geöffnet ist, natürlich mit Online-Anmeldung und den üblichen Corona-Geboten. Von der Planung an hatte Peter diesen Wellness-Supertempel promotet. Der kleine Urberliner war eine Größe in der PR-Branche. Sein Gedächtnis ist erstaunlich: „Weeste noch, wie ick euch die Münchner U-Bahn vakooft hab...und die Brigitte Bardot?“ Bis vor einigen Tagen konnte er noch mit einem Stock spazieren, zum Jubeltag bekam er einen Rollator. Und zu seiner besonderen Freude einen Glückwunschbrief vom Bundespräsidenten.
„Ick möcht nur wissen, welche Dösköppe uns det injebrockt ham,“ berlinert Peter. Ansonsten bekümmert Corona samt Reglements den Hundertjährigen nicht allzu sehr, wohl aber das Leiden der anderen Alten. Für sie drohe die Pandemie zur „Epidemie der Einsamkeit“ zu werden, meint der Zukunftsforscher Horst Opaschowsky, der selbst schon 80 Jahre auf dem Buckel hat. Tatsächlich meldet die „Bundespsychotherapiekammer“ (was für ein angsteinflößendes Wortungeheuer!) bei vereinsamten alten Menschen deutlich zunehmende Befunde von Depression, Angststörungen, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit.
Ob die Corona-Krise auch die ganz Jungen so kalt lässt wie anscheinend meine beiden alten Weggenossen, das möchte ich bald bei einem – falls möglichen - Kita-Besuch herausbekommen.
26. Oktober 2020
Und wie geht’s denn nun den ganz Jungen? Nach einigen Seniorenheimen besuche ich eine von einer Elterninitiative gegründete Kita in Haidhausen, eine von 1400 privaten oder städtischen Kindertageseinrichtungen in München. Seit September gilt ein Hygienepaket. Unterschieden wird nach drei Stufen. In der zweiten, der gelben Phase zum Beispiel, werden die Kinder in festen Gruppen möglichst von stets derselben Person betreut, dürfen sich nur in ihrer Gruppe und nicht frei im Haus bewegen. Maskenpflicht gilt in München grundsätzlich erst ab dem Alter von sechs Jahren. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn haben Kinder erst von 13 Jahren an einen relevanten Anteil an den Infektionen.
Lion hat kürzlich seinen sechsten Geburtstag gefeiert. Der Vater führte ihn am nächsten Tag in die von Karl Valentin besungene Ritterburg von Grünwald, wobei Lion mit Stolz seine Maske und sein  Holzschwert anlegte. In der Kita, vier Tage später, muss sich der Vater beim Eintritt maskieren, Lions drei Betreuer müssen es fortwährend. Der Bub trägt eine Windjacke überm Pulli. Es kann nämlich kalt werden, alle 20 Minuten muss mindestens drei Minuten gelüftet werden, wie auch von der Bundeskanzlerin höchst persönlich empfohlen. Es gefällt Lion recht gut in diesem Tagesheim fern der Eltern. „Wenn die Vorschule rum ist“, plaudert er, „dann dürfen wir spielen.“ Begeistert erzählt er von verschiedenen Spielen, bis hin zur Kissenschlacht.
Holzschwert anlegte. In der Kita, vier Tage später, muss sich der Vater beim Eintritt maskieren, Lions drei Betreuer müssen es fortwährend. Der Bub trägt eine Windjacke überm Pulli. Es kann nämlich kalt werden, alle 20 Minuten muss mindestens drei Minuten gelüftet werden, wie auch von der Bundeskanzlerin höchst persönlich empfohlen. Es gefällt Lion recht gut in diesem Tagesheim fern der Eltern. „Wenn die Vorschule rum ist“, plaudert er, „dann dürfen wir spielen.“ Begeistert erzählt er von verschiedenen Spielen, bis hin zur Kissenschlacht.
Aus meinen Stippvisiten kann ich wohl den Schluss ziehen: Sowohl die ganz Alten als auch die ganz Jungen – viele jedenfalls - kommen mit der Krise ganz gut zurecht.
Jedoch: die Einschläge kommen näher - im eigenen Umfeld. Der Freund meiner Enkelin, der für eine Snowboardfirma arbeitet, war zum Start der Skisaison auf einem Tiroler Gletscher. Danach machte sein Befinden einen Covid-19-Test ratsam. Erster Befund: positiv. Kontaktperson Enkelin Tania anschließend: negativ. Jedenfalls ist unser vereinbartes Treffen geplatzt. Sport in Massen scheint derzeit ebenso riskant zu sein wie Feiern in Massen. Hat nicht unsere Kanzlerin zum Maßhalten gemahnt?
Inzwischen hat die Pandemie auch unsere Sprache verseucht. Dazu ein erfundenes, etwas makabres Muster: Wenn sich Kids nach anstrengendem Home-Schooling oder Youngster nach Home-Officeoder oder echter Maloche irgendwo zum Feiersetting treffen oder nur zum Chillen in einer wechselnden Community, dann wird schnell ein Hotspot aus dem Meeting. Von da aus können Superspreader das fucking Virus massenhaft verbreiten, so dass sich Infektionskurven, Inzidenzwerte und Reproduktionszahlen dem kritischen Limit nähern und vielleicht ein Shutdown oder ein Comeback des Lockdowns fällig werden. Wenn nicht gar, dann wenn auch die Todesrate boomt, das bisher verdrängte Problem der Triage wieder auftritt. Lost. Übersetzung gefällig? Frag nach bei Google.
Demnächst will ich mich umschauen oder umhören bei 20- bis 30-Jährigen. („Twens“ hat man uns in diesem Alter genannt), um ihre fragwürdige oder auch verständlichen Selbstdarstellung, die sie „Setting“ oder „Clubkultur“ nennen, ein wenig zu erkunden.
2. November 2020
Mein derzeitiges Bemühen, die Lebenswelt verschiedener Altersgruppen unter Corona-Bedingungen konkret zu erkunden und kurz zu beschreiben, ist durch die neuerliche „nationale Kraftanstrengung“ (Angela Merkel) jäh unterbrochen worden. Gut, die ganz Jungen und die ganz Alten sind vom aktuellen „Lockdown light“ (Markus Söder) kaum betroffen, denn die Kitas bleiben noch offen und die Senioren dürfen in ihren Heimen weiterhin besucht werden, alles natürlich unter strengen Auflagen.
Die 20- bis 30-Jährigen jedoch, die ich schon auf dem Schirm hatte, sind durch das Verbot jeglicher Freizeit- und Sportaktivitäten derart betroffen, dass Anpassungen an die scharfen Regeln, wie versucht, so gut wie ausgeschlossen sind, mindestens bis Ende November. Das heißt nicht weniger als dass die Betreiber von Kneipen und Bars in ihrer Existenz noch mehr bedroht sind als durch die bisherige Sperrstunde. Es war wohl mehr ein Akt der 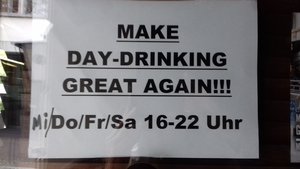 Verzweiflung, als Joe, ein junger Barkeeper im Lehel die halblustige Parole plakatierte: „Make day drinking great again“. Andere Kneipiers hatten schon ganz zugemacht: zu viel Hygiene-Aufwand, zu hohes Bußgeld, zu wenig Gäste.
Verzweiflung, als Joe, ein junger Barkeeper im Lehel die halblustige Parole plakatierte: „Make day drinking great again“. Andere Kneipiers hatten schon ganz zugemacht: zu viel Hygiene-Aufwand, zu hohes Bußgeld, zu wenig Gäste.
Was aber wird mit den meist größeren, schummrigen Tanzschuppen mit Clubcharakter, die seit Monaten bereits dicht sind? Klar, sie wären wohl die vorderste Front für den kleinen bösen Feind. Das hat auch Markus Söder, als Tänzer nicht ganz untalentiert, schon des Öfteren kundgetan, zuletzt mit einem rigorosen Ratschlag: „In den Clubs ist die Ansteckungsgefahr einfach mit am höchsten. Aber Sie können ja zum Beispiel zu Hause mit Ihrer Partnerin tanzen.” In den sozialen Medien gab es daraufhin zigtausende mehr oder weniger empörte Reaktionen.
„Die Clubkultur geht kaputt.“ So rumort es in betroffenen Kreisen bereits seit Langem. Bedeutet dies nun tatsächlich das Ende eines Angebots, das zur Lebenswirklichkeit einer Generation geworden ist?
9. November 2020
Was treiben jetzt - unter den verschärften Auflagen – die unter Generalverdacht stehenden Clubs? Einer, der das wissen müsste, ist Peter Wacha. Er hat in München einen gutgehenden Club nach dem anderen aufgemacht und als DJ unter den 18- bis 30-Jährigen beliebt gemacht, angefangen mit dem Tanzschuppen Ultraschall, der in einer Küche des aufgelassenen Flughafens Riem entstand. Mit seinen 58 Lebensjahren ist Wacha auch kaum mehr dem aktuell auffälligen Party-Volk zuzuordnen. Ich treffe ihn in der legendären Roten Sonne am Maximiliansplatz.
Hier befanden sich einst die Thermen des zerbombten Regina-Palasthotels, in denen wir als junge Leute in den 1950er-Jahren tollen Fasching feierten (der Pool diente als Tanzboden). Jetzt zeigt eine Leuchtschrift draußen an, wie viele Tage hier schon seit Mitte März „closed“ ist. In einem der Kellerräume - zuletzt war dort eine Lesben-Bar versteckt - hat Wacha seit 2005 mit drei Freunden einen Live-Club, den ein Musikmagazin regelmäßig als den besten in Europa prämiert, eigenwillig stilisiert und gemanagt.
Nach dem ersten, dem großen Lockdown wollte sich die Münchner Clubszene mit Livestreams und städtisch geförderten Open-Air-Konzerten wieder sicht- und hörbar machen. Aber unentgeltliche Musik, vereinzelt als „Dumpingkultur“ geschmäht, beglich keine Mieten, keine Gehälter. Ein Club musste sogar 40 Studentinnen ausstellen.
Auch Wacha hatte viel Geld in die Sonne gesteckt. Das Interieur erinnert ein bisschen ans Oktoberfest selig:  schwarze Wände mit wenigen Knallfarben und Kacheln aus den sanierten Kammerspielen, raffinierte, mit Ökostrom betriebene Licht- und Ton-Spiele, ein Teppichboden, der beim Tanzen vibriert.
schwarze Wände mit wenigen Knallfarben und Kacheln aus den sanierten Kammerspielen, raffinierte, mit Ökostrom betriebene Licht- und Ton-Spiele, ein Teppichboden, der beim Tanzen vibriert.
Mit „NoDance“ entwickelte das Team zum Herbst ein Projekt, das trotz des anhaltenden Verbots von Clubs und Live-Musik einen geregelten Betrieb zu ermöglichen schien. Die Rote Sonne sollte „bespielt“ und „beschallt“ werden: mit Kunst, vornehmlich Klanginstallationen. Auch wollte Wacha zwei Räume „betischen und vorsichtig ein anspruchsvolles, eher experimentelles DJ-Programm bieten“. Der Brite Brian Eno, eine Größe in der Musikbranche, war für November angeheuert. Garantiert war natürlich eine strenge Kontrolle von Maskenpflicht und Abstand zwischen den Stehtischen. Und: No party mood.
Der jüngste Lockdown jedoch warf auch dieses ausgeklügelte Projekt „down“. Peter Wacha schickte seine Mitarbeiter in Kurzarbeit und fuhr mit seinem Sohn in den Böhmerwald, dem er entstammt. Aufgeben ist für seinesgleichen aber „keine Option“. Vielmehr empfiehlt er seinen - oft jammernden, auf Staatshilfe wartenden - Kollegen einen gesunden Optimismus. Wie andere Kulturschaffende glaubt er, Kreatives aus der Krise schöpfen zu können, ohne seine Leidenschaft und seine Ziele zu vergessen. Wie wäre es zum Beispiel, denkt er schon wieder weiter, die uralte Ultraschallanlage aus dem Start-Club auf Räder zu setzen und ein mobiles System Rote Sonne zu schaffen? „Dann könnten wir doch Musik auf öffentliche Plätze bringen.“ Warum auch nicht.
16. November 2020
„München leuchtete,“ erzählte Thomas Mann anno 1902. „München leuchtet heller denn je“, wünscht der Lichtkünstler Manfred Beck im trüben November 2020. Er hat von den City Partners München den Auftrag bekommen, an einigen markanten Plätzen der Stadt extra starke Lichtinstallationen anzubringen. Das Kreisverwaltungsreferat hat die Aktion genehmigt. Damit soll die Düsternis der Pandemie wenigstens ein bisschen überstrahlt und den Münchnern doch noch ein wenig Weihnachtszauber geboten werden.
Denn dieser Advent steht unter keinem hellen Stern. Fast alles, was die „staade Zeit“ einst ausgemacht hat, ist den Seuchengesetzen zum Opfer gefallen: der große Christkindlmarkt und die meisten kleinen, das Winter-Tollwood-Festival, die über die Stadt verstreuten Standl mit Glühwein- und Lebkuchengeruch, der Shopping-Rummel mit seinem oft aufdringlichen Klingeling und Nikoläusen. Was viele Geschäftsleute nicht davon abhält, viele Lichter leuchten zu lassen in ihren weithin leeren Läden. Und immerhin: Auf dem fast ebenso menschenarmen Marienplatz soll Ende November doch noch, wie jedes Jahr, eine mächtige leuchtende Fichte aufgestellt werden.
Es weihnachtet zwar nicht sehr, aber a bisserl was geht immer, wie der Monaco Franze wusste. Und nun warten wir halt alle, wie die Feiertage selbst werden. „Zu Weihnachten besser dazustehen“, das war ja für Markus Söder das erklärte „große Ziel“ seines „Lockdown light“. Ach ja, Weihnachten. Wird das schönste Fest der Christenheit der Tristesse ähneln, wie wir sie zu Ostern erlebt haben?
Eigentlich müssten sich die beiden Feierwochen doch wesentlich unterscheiden: Damals, im Frühjahr, drang aus den Städten - frei nach Faust - „ein buntes Gewimmel hervor“. Die Weihnacht dagegen war immer ein Fest der Familie. Man versammelt sich unter dem Christbaum, sortiert Geschenke, stimmt vielleicht in die aus allen Tongeräten klingenden Chöre ein. Solche Tradition müsste doch trotz der „corona-bedingten Einschränkungen“ nachvollziehbar sein. Allerdings wohl nur in kleinerem Kreis. Würden nämlich Opa, Oma, Onkel, Tante u.a. die mehrköpfige Familie besuchen wollen, dann käme so eine Weihnachtsparty mit dem derzeitigen Corona-Gesetz in Konflikt.
Was jedenfalls fehlt, ist die festliche Stimmung. Die nun aber soll der forcierte Einsatz von Lichtkunst und elektrischem Kerzenschein kleinweise in die vorweihnachtliche Stadt zaubern. Bald danach steht die nächste Bewährungsprobe für kreative Improvisierer bevor: der Münchner Fasching.
23. November 2020
Jetzt bin ich selbst in die Corona-Mühle geraten. Im Familienkreis wollte ich wieder mal auf dem schönen Höhenweg von Bayrischzell nach Osterhofen wandern. Schon bei der ersten geringen Steigung blieb mir, obwohl maskenlos, buchstäblich die Luft weg. Dem Schock folgte die Angst: Ist nicht Atemnot eines der typischen Symptome und der bleibenden Folgen einer Covid-19-Infektion? Laut NetDoktor deutet Atemnot sogar auf einen schweren Verlauf der Krankheit hin.
Daheim, in der freiwilligen Quarantäne, wurde es rasch schlimmer. Ich musste den Ärztlichen Notdienst rufen. Zur quälenden Atemlosigkeit kamen eine gewisse Appetitlosigkeit und schnelle  Erschöpfung, nicht aber Fieber oder Husten. Höchste Zeit für einen Coronavirus-Test. Meine Hausärztin nahm den Abstrich vom Fenster aus vor, um keine Patienten in der Praxis zu gefährden, ich stehe dabei draußen auf der Liebigstraße. Der Befund: zum Glück negativ.
Erschöpfung, nicht aber Fieber oder Husten. Höchste Zeit für einen Coronavirus-Test. Meine Hausärztin nahm den Abstrich vom Fenster aus vor, um keine Patienten in der Praxis zu gefährden, ich stehe dabei draußen auf der Liebigstraße. Der Befund: zum Glück negativ.
Jedenfalls aber habe eine massive Dyspnoe: eine anhaltende Atemnot - vermutlich in Verbindung mit altersbedingter, noch abzuklärender Herzschwäche. Und jedenfalls erfahre ich aus dem Netz: Panikstimmung und Stress könnten durchaus zu Sauerstoffabfall mit plötzlicher Atemschwäche beitragen, also nicht nur umgekehrt. Ich bin in der Mühle, ich ziehe die Konsequenz: Künftig werde ich die Mahnungen von Wissenschaftlern und kompetenten Politikern sowie die daraus abgeleiteten, noch so harten Maßnahmen noch penibler als bisher beachten, auch wenn sie uns allen vorübergehend ein Stück Lebensqualität nehmen.
Eine Frage drängt sich mir noch auf: Wie viel Dummheit und Rücksichtslosigkeit zum Schaden der Gesellschaft wollen sich einzelne Mitbürger, junge wie alte, denn noch leisten? Was für eine Art Virus spukt in den Köpfen sogenannter „Querdenker“ und anderer, die Verzicht und Disziplin anscheinend nie gelernt haben? Leute, werdet vernünftig, bevor auf den Intensivstationen die Beatmungsmaschinen knapp werden! Erkennt wenigstens diese rechten Rattenfänger, die ihre Ziele durch die allgemeine Verblödung näher rücken sehen.
Apropos „Querdenker“: das Wort stammt von Kurt Tucholsky. Er hat es unserem Karl Valentin zugedacht. Der Berliner Satiriker hat sich auch viele Gedanken über Seuchen gemacht. Zum Beispiel über die Spanische Grippe von 1919 mit 50 Millionen Toten: „Was schleicht durch die kriegführenden Länder...?“ Lustiger ist die lange Abhandlung über die gemeine Grippe, die Tucho als Peter Panter 1931 so enden ließ: „Die Grippe ist keine Krankheit – sie ist ein Zustand.“ Dieser handschriftliche Text hängt als Kopie im Wartezimmer meiner Hausärztin. Angebracht hat es ihr Vorgänger. Der leitet heute zusammen mit seinem Zwillingsbruder jenes Biopharma-Unternehmen, das den ersten verheißungsvollen Impfstoff gegen die derzeitige Pandemie entwickelt hat. Seltsame Zusammenhänge, nicht wahr?
30. November 2020
Was für ein verqueres Denken, was für eine Verwirrung der Geister, was für Unverschämtheiten! Da wird ein Kind mit einem dümmlichen Plakat auf die Bühne einer Gegen-Alles-Shows geschoben, während eine 22-Jährige sich selber mit Sophie Scholl vergleicht, weil auch sie „nicht aufhören will, für die Freiheit zu kämpfen“. Der gelbe Stern taucht wieder auf. Soll wohl heißen: So wird man hierzulande wieder stigmatisiert. Oder auch: An allem sind die Juden schuld, auch an der aktuellen Weltseuche, die sie für die Weltherrschaft bräuchten. Nicht nur die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) hält derlei Auswüchse der „coronabedingten“ Volksverhetzung für unerträglich. Erfreulich immerhin, wenn Ordner spontan eingreifen; das genügt aber nicht. An alle: Sagt NEIN!
Dies ist die eine, die abscheuliche Seite der Medaille, die eine Mikrobe in Form einer Krone („Corona“) zeigen müsste. Die Kehrseite indes zeigt Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, auch bei der oft verpönten „Jugend“. Ungewohnte Erscheinungen, die mir schon zu Beginn der Epidemie in meiner Nachbarschaft aufgefallen waren. Und die man jetzt, als Angehöriger der Hochrisikogruppe (mit frisch diagnostiziertem Lungenödem), durchaus zu würdigen weiß. Nach einer aktuellen Umfrage ist es für zwei Drittel der 14- bis 39-Jährigen nunmehr wichtig, zum Schutz von Familie und Freunden auf Partys zu verzichten, und sogar für 73 Prozent sind die verschärften Hygienevorschriften kein Problem. (Im Umkehrschluss heißt das freilich, dass vielen Mitbürgern so viel Rücksicht doch noch fremd ist).
Zur neuen Solidarität gesellt sich ein eher fragwürdiger Rückzug ins Private und, ja, auch in die Idylle einer „guten alten Zeit“, zu welcher die Vergangenheit „vor Corona“ anscheinend schon gereift ist. Jedenfalls lassen es sich viele Groß- und Kleinhändler im Stadtzentrum nicht nehmen, ihre schlecht besuchten Läden weihnachtlich zu schmücken. In Münchner Vororten wurden sogar richtige Christkindlmärkte en miniature inszeniert. Wie gesagt: München leuchtet auf kleinster Flamme.
Tadellos funktioniert unser örtliches Netzwerk „nebenan“. Wer sich allzu sehr down, also durch Kontaktsperrgebote angeödet fühlt, der findet hier Angebote für Abstand wahrende Winterspaziergänge oder für digitale Workshops zum Basteln von Weihnachtsgeschenken. Oder für allerlei passende Utensilien, von Kerzenwachsresten bis zum Bäumchen aus dem eigenen Garten. Außerdem bekommt man Tipps, wie man in der sowieso „staaden Zeit“ einsame Nachbarn in adventliche Stimmung versetzen könnte. Beispielsweise wird zum gemeinsamen Singen auf dem Balkon oder zu einem Gespräch am Telefon angeleitet. Fachkundig empfiehlt jemand Lichtinstallationen an Fassaden „zum leuchtenden, traurigen Erinnern“.
Eine andere Aktion sind die von der Stadtbibliothek angeregten „Wunschbäumchen“ in einigen Stadtteilen. Daran soll man Geschenke im Wert bis zu 20 Euro hängen, die Waisenkindern, alleinstehenden Senioren und anderen Bedürftigen zugutekommen sollen. Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zufolge dürfte die Corona-Krise die Armut und die soziale Ungleichheit in Deutschland noch einmal spürbar verschärfen.
7. Dezember 2020
Ein Jahr Corona! Wirklich schon ein ganzes Jahr? Bei neuerlichen Recherchen für dieses Tagebuch fiel mir auf, dass der genaue Zeitpunkt des Ausbruchs nicht festzumachen ist. In chinesischen Sekundärquellen wird dafür - allerdings nachträglich - mal der 1. und mal der 8. Dezember 2019 genannt. An einem dieser Tage sollen bei einem 61-jährigen Mann in der zentralchinesischen Stadt Wuhan erstmals Symptome einer grippeartigen Virus-Infektion der Atemwege diagnostiziert worden sein, der Mann litt außerdem an Krebs. Er hatte auf einem Fischmarkt eingekauft. Als „Patient Null“ wird aber auch eine 31-jährige Frau genannt.
Erst am 31. Dezember aber berichtete die Regierung in Peking das Auftreten des mutierten SARS-Erregers in Wuhan an die Weltgesundheits-Organisation (WHO). Drei Tage später wurde die Elf-Millionen-Stadt von der Außenwelt abgeriegelt. Das Virus begann seine Wanderung durch die Medienwelt – und die reale Welt. Am folgenden Tag meldete die Süddeutsche Zeitung knapp: „Lungenkrankheit in China“: 44 Menschen seien erkrankt und in Quarantäne, elf befänden sich in Lebensgefahr. Zwar waren bereits einige Flughäfen in Ostasien gesperrt, das neue, sehr aggressive Virus aber gelangte noch im Januar 2020 auch in die USA und nach Europa. Am 24. Januar dockte es bei Angestellten einer Autozulieferfirma nahe von München an. Und das Unheil nahm seinen Lauf. Seither habe ich Tag für Tag darüber reflektiert und notiert.
Der Jahrestag und die bevorstehende Massenimpfung würden nun Gelegenheit bieten, die - am 11. März von der WHO erklärte - Pandemie historisch einzuordnen. Schon beim ersten Lockdown war ja deutlich geworden, dass Corona diese unsere Hightech-Welt vielleicht ähnlich verändern könnte wie die Pest die Gesellschaft im Mittelalter, die Cholera das Gesundheitssystem der frühen Industriezeit, die Spanische Grippe den Zeitraum zwischen Krieg und Moderne oder Aids das Sexualverhalten. Jedoch, auf derlei Spekulationen will der Tagebuchschreiber lieber verzichten, das Thema ist zu groß. Vielmehr möchte ich mit wenigen Zitaten aus kürzlich archivierten Mails einfach nur ein paar Gedanken meiner Bezugspersonen kommentarlos weitergeben – vielleicht als Signale Bangen und Hoffen:
„Ein schwieriges und, gelinde gesagt, recht ‚kontaktarmes‘ Jahr geht in die letzte Runde – immerhin mit einiger Hoffnung auf fröhlichere Zeiten dank der angekündigten Impfungen. Die Vorweihnachtszeit müssen wir allerdings noch ganz besonders vorsichtig und zurückgezogen hinter uns bringen, um Corona keine Chance zu geben. Das heißt leider auch, dass selbst unsere seit dem Dezember 2000 (!!!!) traditionelle Weihnachtslesung dem Virus weichen muss.“
„Das Virus bestimmt nach wie vor unser Leben und damit auch unseren Presseclub. Für den Fall, dass die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in der nächsten Woche für den Rest des Jahres keine Erleichterung bringt, wird der Club im Dezember geschlossen. Da im Moment nichts für Lockerungen spricht, müssen wir also damit rechnen, dass wir das Gespräch über unser München (und auch über unsere so hoch geschätztes, aber leider verstorbene Ehrenmitglied Hans-Jochen Vogel) ins nächste Jahr verschieben müssen.“
„Auch Weihnachten darf nur im engsten Kreis gefeiert werden und selbst Silvester wird dieses Mal bestimmt ziemlich leise und friedlich verlaufen. Das endende Jahr selbst veranlasst ja nicht gerade zum Feiern und was das neu beginnende Jahr bringen wird, ist auch noch nicht absehbar. In den ersten Monaten mit Sicherheit noch keine allzu großen Veränderungen. Das wir einmal mit so einer Situation leben müssen, hätten wir alle niemals gedacht. Aber es ist nun mal so und wir müssen sehen, dass wir das Beste daraus machen.“
„Auch in Corona-Zeiten planen wir natürlich weiter...Wir arbeiten an Plänen, das Museum auf den technischen und architektonischen Stand der Zeit zu bringen, es barrierefrei umzubauen, neue Räume für Ausstellungen und unsere Konzerte und Vorträge zu schaffen, dem Museum höhere Aufenthaltsqualität zu geben und es noch stärker als Ort der Begegnung in Ismaning zu gestalten - unter anderem mit einem Cafébereich und Sitzplätzen im Außenbereich. Für das nächste Jahr planen wir auch wieder Konzerte in der Hoffnung, dass solche Veranstaltungen dann wieder erlaubt und durchführbar sind.“
„Ich habe dem OB Dieter Reiter folgende Fragen gesandt: 1. Schön, dass die Weihnachtstanne vor dem Rathaus steht. Ist geplant, vom Balkon aus in der Adventszeit wenigstens etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten, wo ja sonst in der Innenstadt nichts los ist? Ich denke da an die Musikerinnen und Musiker, Schauspielerinnen und Schauspieler, Autorinnen und Autoren, die seit März Berufsverbot haben und sicher gern Honorare für Konzerte und weihnachtliche Rezitationen und Lesungen von ihrer Stadt bekommen würden. 2. Schämen Sie sich eigentlich, wenn Sie mit dem Stadtrat im Theater tagen, in dem abends nicht gespielt wird? Oder finden Sie, dass das Theater nun endlich mal vernünftig genutzt wird?
„Eine Haltung, die seit Monaten unser Leben bestimmt, ist die Angst. Jedes Gesetz, jede Verordnung entspringt der Angst vor dem Virus. Das ist nachvollziehbar, aber es ist eben nur eine Seite. Wir werden noch eine Weile mit Corona in der Welt leben müssen und das wird nicht die letzte Krise sein.“
„Ja, die Zeiten sind böse, so oder so für uns Menschen weltweit.“
14. Dezember 2020
Aus den Wunschzetteln vorweihnachtlicher Zeiten sind Brandbriefe und Bettelbriefe geworden. Immer mehr Branchen beklagen immer dringlichere Nöte und möchten an staatlicher Hilfe beteiligt werden. Anregung dazu bietet nicht zuletzt der neue „Bayerische Härtefall Fonds“, der nicht rückzahlbaren Zuschüsse zwischen 5000 Euro (bis fünf Mitarbeiter) und 30 000 Euro (bei maximal  250 Mitarbeitern) in Aussicht stellt. Voraussetzung ist, dass interessierte Betriebe „in eine existenzbedrohende Lage gekommen sind oder massive Liquiditätsprobleme haben“. Der Engpass muss nach dem 11. März 2020 eingetreten sein.
250 Mitarbeitern) in Aussicht stellt. Voraussetzung ist, dass interessierte Betriebe „in eine existenzbedrohende Lage gekommen sind oder massive Liquiditätsprobleme haben“. Der Engpass muss nach dem 11. März 2020 eingetreten sein.
Seinerzeit war freilich kaum abzusehen, dass die volle Härte der Maßnahmen einen Stillstand oder Rückfall so vieler Lebensbereiche erzwingen würde, so drastisch wie anhaltend. Längst hat das grenzenlose Virus weit über Schulen, Seniorenheime, Kitas, Krankenhäuser, Kultur, Handel, Gastgewerbe, Freizeit viel Unheil hinausgestreut. Was auch daran liegen könnte, dass so manche Branche, die zunächst nicht betroffen schien, von anderen, gefährdeten Branchen abhängig ist; bestes Beispiel: die zahllosen Zubringerbetriebe der nicht total eingebrochenen Automobilindustrie.
Allein der Ausfall des Oktoberfestes zum Beispiel scheint allerlei Engpässe erzeugt zu haben. So meldet die Abendzeitung: „Totentanz in den Trachtenläden.“ Da liegen sie nun also unberührt in den Schaufenstern, die Dirndl, Janker, Mieder und Lederhosen, während Laptops und Lichterglanz nebenan noch ganz gut Absatz finden – jetzt kurz vor dem erneuten Lockdown. Ein Inhaber dieser Traditionsgeschäfte meint den Grund zu kennen: „Tracht ist ein Ausdruck der Freude und des Lebensgefühls, das ist uns abhandengekommen.“
Hilfsgelder sind für einen solchen Ausfall kaum zu erwarten. Wohl aber dürfen einige Vereine, Initiativen und Einrichtungen aller Sparten, „die das Münchner Kulturleben maßgeblich und langfristig mitprägen“, wieder mit städtischen Fördermitteln rechnen. 20,7 Millionen Euro hat der Kulturausschuss des Stadtrats für 2021 bewilligt. Stolz stellt Kulturreferent Anton Biebl fest: „Trotz erforderlicher Einsparungen wird auf pauschale Kürzungen verzichtet.“ Nicht nur die eh schon subventionierten Institutionen gehören dazu, sondern auch darbende Münchner Mini-Kulturen wie etwa die Schule für bairische Musik, der Verein zur Förderung der Eigenarbeit oder die Tanzschule Europa.
Gewöhnt hat man sich daran, dass die 1250 bayerischen Museen sowie die großen Theater durch Brandbriefe und Kundgebungen auf finanzielle Unterstützung drängen, wobei entweder der Staat oder die Stadt oder gleich beide angesprochen werden.
Schrecklicher noch, dass die Regensburger Schlossherrin Gloria von Thurn und Taxis, nachdem ihr der lukrative Weihnachtsmarkt schon von Söders sogenannten Lockdown light vermiest wurde, nun laut Süddeutsche Zeitung auch noch die Rentabilität ihrer Wälder durch die – nach ihrer Ansicht keineswegs menschengemachte - Klimaerwärmung gefährdet sieht. Und so fleht sie, der Staat möge doch den privaten Großwaldbesitzern „unter die Arme greifen“. Da kommt einem Herr Puntila in den Sinn, Brechts komischer Kapitalist mit seinen Wäldern.
„Völlig ungenügend“ findet auch der Taxiverband München die Fördermaßnahmen. Immerhin sind zurzeit über 1000 der 3300 Konzessionen stillgelegt. Und die noch dienstbereiten Fahrer warten viele Stunden auf Kunden, trotz eingebauten Glaswänden und strengem Maskenzwang. Die Idee, Personen mit ÖPNV-Karten gratis zu befördern, ist gescheitert.
Zu den Bittstellern im Bayern gehören auch die kleinen, überwiegend familiengeführten Landbrauereien, die ihre Lage „dramatisch, wenn nicht existenzbedrohend“ schildern. Und sogar die Bäcker verlangen ein Stück vom verteilbaren Kuchen, denn ihnen ist der Kaffee-Ausschank abhandengekommen. Die Brotzeit „to go“ ist nicht immer gefragt, vor allem nicht bei Kälte.
Mit dem ersten Schnee sahen sich auch die Bergbahn- und Liftbetreiber genötigt, auf die Skikanonen zu steigen. Kein Wunder, haben sie doch wieder viel Geld in die Wintersport-Infrastruktur investiert, und nun wird ihnen ausgerechnet die Hochsaison im ganzen Alpenzirkus vermasselt. 20 Bürgermeister aus dem Allgäu schickten einen Brandbrief an die Bundeskanzlerin, während die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen den bayerischen Regierungschef warnte, dass die Versorgung von verunglückten Skitourengehern, mit denen zu rechnen ist, bei stillgelegten Beförderungsbetrieben gefährdet sei. Manche Argumente werden weit hergeholt.
Nicht ausbleiben konnte, dass auch immer mehr Betrüger versuchen, die finanzielle Freizügigkeit beim Abfedern von Corona-Schäden auszunutzen. Das Bayerische Landeskriminalamt meldet bisher mehr als 1400 verdächtige Fälle, bei denen mindestens fünf Millionen Euro öffentlicher Hilfe beantragt wurden. Den eingetretenen Schaden kann das BLKA „noch nicht abschließend bewerten”. Der simpelste Trick ist der Anruf eines angeblich erkrankten Angehörigen, für die Geld hinterlegt werden soll. Falsche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bieten teure Tests an der Haustür an. Und „Fachleute“ wollen Leute im Homeoffice (meist auf Englisch mit indischem Akzent) zur Installation einer Fernwartung überreden.
Eine persönliche Anmerkung: Wegen meiner „Münchner Meilensteine“, deren Präsentation das Virus verhindert hat, und der anhaltenden Flaute im Buchhandel habe ich über einen Antrag auf staatlichen Einkommensausgleich nicht nachgedacht. Der Bayerische Journalistenverband meldet, dass die Honorareinnahmen vieler Mitglieder bis zu 100 Prozent eingebrochen sind.
21. Dezember 2020
Keine nächtlich lockenden Christmetten, kein feierliches Hochamt, keine stimmgewaltigen Chöre, keine lauten Posaunen, nur Orgeln. Der von einem christlich positionierten Politiker verkündete Lockdown samt nächtlicher Ausgangssperre ist wahrlich keine Frohe Botschaft. Er greift tief ein ins religiöse Leben. Die Partitur kommt von der Physik.
Erst im August haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass in Raumluftproben, die Patienten mit Covid-Symptomen entnommen wurden, noch in einer Entfernung von fast fünf Metern aktive Erreger-Teilchen messbar sind. Ausgestoßen werden sie von der Lunge mit der menschlichen Stimme oder Blechinstrumenten. Übertragen werden sie durch. Schützende Abstände sind auch in Kirchenräumen keine Selbstverständlichkeit. Ungeklärt ist nur noch, ob die mit der Luft transportierten Virenpartikel ausreichen, um weitere Personen zu infizieren.
Jedenfalls haben die Kirchen allen Grund zur Vorsicht. Frage: Stört Corona nicht nur die weihnachtliche Stimmung, sondern auch die Liturgie, den Grundstein religiösen Lebens? Vorläufige Antwort; Ja, aber nicht ganz. Der Mann, der einen Weg aus dieser Sackgasse gefunden hat, heißt Rainer Maria Schießler. Und der Ort, wo die Weihnachtsbotschaft alle Hindernisse durchdringt, ist die  Maximiliankirche im Münchner Glockenbachviertel. Bis zum 19. Januar noch werden in diesem „Notre Dame an der Isar“ morgens und abends Messfeiern zelebriert, wie sie froher, schöner, inniger kaum sein könnten.
Maximiliankirche im Münchner Glockenbachviertel. Bis zum 19. Januar noch werden in diesem „Notre Dame an der Isar“ morgens und abends Messfeiern zelebriert, wie sie froher, schöner, inniger kaum sein könnten.
Eigentlich wollte der ungewöhnliche Pfarrer Schießler, der Kirche gelegentlich auch aufs Oktoberfest und zu Obdachlosen hinaustrug, in erster Linie den derzeit völlig „freien“, einkommenslosen Künstlern unter den Arm greifen, indem er ihnen bei insgesamt 36 Gottesdiensten ein Podium bietet und einen Opferstock für „musikalische Begleitung“ hinstellt; 700 Euro pro Auftritt sind dank einer Stiftung garantiert, desgleichen ein volles Programm: Volkslieder, Jazz, Experimente, Weltmusik. Zwar sind derzeit keine Konzerte erlaubt, Gottesdienst aber schon.
Einen Höhepunkt erreichte das durchaus trickreiche Programm bei einem Abend mit dem Konstantin Wecker Trio, das noch abrufbar ist. Lieder gegen Angst und Einsamkeit, Lieder für Frieden und Freiheit, wechselten mit Psalmen und kurzen Predigten. Ungehörte Texte und wunderbare Melodien rührten die Herzen der eingelassenen per Streaming zugeschalteten Menschen: „Mit der Zeit muss alles sterben, aber nicht im Augenblick.“ Im Gespräch mit Schießler, betont bayerisch geführt, knüpfte Wecker – er stellte sich vor als meditativer Kirchenbesucher sowie als „Pazifist und Berufssänger“ - brandaktuell an die Botschaft von Bethlehem an: „Mit den heutigen Rüstungsausgaben ließen sich alle Corona-Schulden bezahlen.“
Für den Heiligen Abend 2020 haben Schießler und sein Pfarrvikar Dr. Michael Shin ein noch ungewöhnlicheres Programm ausgetüftelt: Ab 12 Uhr gibt es, abwechselnd jede Stunde, Gottesdienst und Musik. Jeder kann kommen und gehen, wann er will. Auseinander gezogen wird auch die sonst am Altar postierte Krippe. Eine Dame hat für die 30 übergroße Figuren sogar eigene Schutzmasken genäht.
4. Januar 2021
Die Tage des Innehaltens sind vergangen. Sie waren nur ein Intermezzo zwischen einem knappen Jahr, das für viele ein böses, ein verlorenes Jahr war, und einem Jahr der Ungewissheit und der zaghaften Hoffnung. Sie sollten uns eigentlich, so wurde allenthalben gepredigt, vom Seuchenstress weg zurückführen zur intensiveren Beschäftigung mit dem eigenen Ich und den nächsten Angehörigen. Für mich gewöhnten Homeworker waren es eher Tage des Lesens, der Leeren und der Lehren. Was haben uns diese Feier- und Brückentage gelehrt?
Es ist die vermeintliche Einsamkeit, die einen in Freiheit aufgewachsenen Menschen in den vier Wänden allzu bald bedrückt. Dem folgt, nach einer gewissen Zeit, das Gefühl des Eingesperrtseins. „Wie in einem Gefängnis“ war sich mein alter Freund Hans schon in der Frühphase des ersten Lockdowns im Seniorenheim vorgekommen. Gegenwärtig kann auch der, dem die Türen (noch) offenstehen, gut nachempfinden, wie Isolation von der Außenwelt - zum Beispiel in Quarantäne, im Krankenhaus oder im Knast – auf die Seele wirken kann. Lehre Nr.1: Alleinsein und Nichtstun ist nichts für jedermann.
Nach kurzer Zeit stellt sich ein Drang ein: Nichts wie raus! Doch wohin? Kurzbesuche bei Freunden waren an den freien Tagen ebenso unerwünscht wie Ausflüge in Erholungsgebiete, wo Landräte protestierten. „Verreisen Sie nicht, treffen Sie möglichst nur wenige und wenn, dann nur dieselben Menschen“, hatte RKI-Chef Wieler kurz und knapp geraten. Auch der tägliche Spaziergang zum Luftschnappen brachte manchmal weniger Befreiung als Beklemmung, zumal bei trübem Wetter. So wie Christian Ude empfand ich es „makaber, wie tot die Stadt ist“. Fast ängstlich wichen die wenigen, von Infektions- und Todeszahlen umschwirrten Passanten vor einander aus. Gelegentlich kam es mir vor wie eine Runde im Gefängnishof. Lehre Nr.2: Der Mensch braucht die Nähe des Menschen.
Wenn sich dem Eindruck von – objektiv oft nicht begründeter – Vereinsamung ein Angstgefühl hinzugesellt und keinen Ausgleich findet, kann es zu einer verheerenden Stimmungslage kommen. In einer aufwühlenden SZ-Reportage aus einem Psychiatrischen Klinikum in Thüringen lese ich, dass dort täglich Menschen mit Depressionen, akuten Angst- und Zwangsstörungen aufgenommen werden, das Haus sei „bis unters Dach belegt“ mit Patienten, die an Pandemie-Ängsten leiden. Auch Münchner Krisendienste meldeten vermehrte Telefonnotrufe und Einsätze, oft ausgelöst durch familiäre Konflikte oder „unerträgliche Einsamkeit“.
Nicht nur die Älteren sind betroffen. Nach einer bundesweiten Studie sollen 46 Prozent der 15- bis 30-Jährigen zugestimmt haben, Angst vor der Zukunft zu haben. Aus dem Münchner Stadtjugendamt verlautet indes: „Pandemiebedingt hat besonders die Einzelfallarbeit unserer Streetworker zugenommen.“ Aus Mexiko berichtet mir meine Schwester, dass sich zwei 14-Jährige vermutlich aus Angst vor Corona das Leben genommen haben. Lehre Nr. 3: Angst macht alles noch schlimmer.
Und auch das lehrt die Corona-Krise zu Jahresbeginn: In einer Stadt mit 54 Prozent Einzelpersonenhaushalten, sprich Singles, stellen sich ganz neue Herausforderungen. So hat die CSU-Fraktion eine „Fachstelle gegen Einsamkeit“ gefordert. Sie solle eine Struktur schaffen, um einsame Menschen schnell zu erreichen und aus der Isolation heraus zu holen. Darüber hinaus will man dem in der Großstadt „schleichenden, gesellschafts- und gesundheitspolitisch unterschätzten Phänomen Einsamkeit“ auf den Grund gehen. Einsamkeit sollte allerdings nicht mit Alleinsein gleichgesetzt werden. Als erstes Zeichen der Verbundenheit mit diesen Menschen fordert die CSU in einem Dringlichkeitsantrag eine „Münchner Kindl Aktion“ Briefe gegen die Einsamkeit.
11. Januar 2021
Statt der Skiferien in Tirol, die ich mir um diese Zeit alljährlich geleistet habe, blieben diesmal nur „Reisen in die eigene Stadt“ (so hatte ich vor vielen Jahren einen Bericht über eine touristische Innovation betitelt). Immerhin lässt sich auch auf solchen Nahreisen manch Neues entdecken. Corona hat viel verändert, nicht zuletzt das Bild der Städte.
Wiederholte Sperrzeiten, Ortsverweise, Alkoholverbote, öffentliche Mahnungen, pausenlose Polizeikontrollen und dann noch ein Kälteeinbruch haben jedenfalls bewirkt, dass sich bisherige Hotspots in München wieder in ganz normale Plätze verwandelt haben. Beispiele: Wedekindplatz, Gärtnerplatz, Bahnhofsvorplätze, Hackerbrücke und einige Isarbrückenköpfe. Keine Gruppenbildungen mehr, keine Frust-Demos, keine Partys – der Respekt vor der Pandemie scheint ausgerechnet über die Feiertage endlich auch in feierfreudigen Volksteilen angekommen zu sein. Die Periode bis zur Impfung, so vielleicht die Spekulation in der hauptbetroffenen Jugend, lässt sich wohl irgendwie überbrücken.
Keinerlei Möglichkeit zu gefährlichen Kontakten bietet heuer der Fasching. Die Narrhalla hat die Ballsaison komplett abgesagt, nachdem sie erst noch durchstarten wollte. Denn die organisierte Narretei ist eng mit dem Seuchengeschehen verbunden: Es waren ja die Münchner Schäfflergesellen, die sich nach einer Pestwelle im 16. Jahrhundert als Erste wieder auf die Straße wagten; ihre alle sieben Jahre fälligen Tänze gehören zur Tradition. In diesem besonderen Jahr nun müssen Kurzvideos und Livestream das öffentliche Faschingstreiben ersetzen; es soll ja nicht ganz sterben.
Inzwischen haben sich im derzeit recht bauwütigen München andere „Hotspots“ gebildet, wo man in gebotenem Abstand flanieren kann, auch in Grüppchen, ohne von Polizei auseinander getrieben zu  werden. So drängen Fußgänger und Radler gern auf den neuen, elegant über die Bahngleise geschwungenen Arnulfsteg, der somit die Funktion der Hackerbrücke übernimmt, wo Massen von jungen Leuten, mit Flaschen in der Hand auf verschnörkeltem Geländer hockend, gern den Sonnenuntergang erwartet haben. Andere Abendbummler lockt das Werksviertel, obwohl es noch eine riesige Baustelle ist.
werden. So drängen Fußgänger und Radler gern auf den neuen, elegant über die Bahngleise geschwungenen Arnulfsteg, der somit die Funktion der Hackerbrücke übernimmt, wo Massen von jungen Leuten, mit Flaschen in der Hand auf verschnörkeltem Geländer hockend, gern den Sonnenuntergang erwartet haben. Andere Abendbummler lockt das Werksviertel, obwohl es noch eine riesige Baustelle ist.
Mit Einbruch der Dämmerung belebt sich vor allem auch das Kunstareal. Lichtkünstler haben 18 nach wie vor geschlossene Museen und andere Häuser durch raffinierte Installationen miteinander verbunden und markiert. Aus der Alten Pinakothek, vor der Kugeln rollen, schauen Gesichter von Gemälden, Beamer strahlen von Dach zu Dach, ein ganzer „Lichtwald“ erhellt die Dunkelheit täglich bis 21 Uhr - bis in den Februar hinein. Die von der Stadt geförderte Lightshow soll zu Entdeckungsreisen laden - zum gefälligen Besuch in der von allen ersehnten Zeit „nach Corona“.
18. Januar 2021
Wird sich der Ring um München schließen, werden anderthalb Millionen Menschen bald von der Außenwelt abgeschlossen sein – so ähnlich wie mehrmals im Mittelalter oder wie die nordafrikanische Stadt Oran in Albert Camus’ derzeit vielgekauftem Schreckensroman „Die Pest“?
„Nach Stand heute“ (Jens Spahns Kennwort) liegt der Münchner Inzidenzwert bei 123 und somit deutlich unter dem willkürlich festgelegten Limit von 200, das das Verbot touristischer Tagesausflüge mehr als 15 Kilometern über die Wohnort-Grenze hinaus bedeuten würde. Die sinkende Tendenz macht es momentan auch eher unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit nicht einmal mehr die Kreisstädte Wolfratshausen und Ebersberg angefahren werden dürfen.
Aber 50 bis 100 Kilometer südlich der Landeshauptstadt ist für uns Münchner schon Schluss mit lustig. Zunächst bis zum 31. Januar hat der große Landkreis Miesbach, der selbst drei knallrot markierte Gemeinden aufweist, ein Einreiseverbot erlassen, wobei nicht versäumt wurde, mit Bußgeld zu winken sowie die Einwohner aufzufordern, Verstöße der Polizei zu melden.
Zuvor schon hatten Kommunalpolitiker in einigen bergnahen, seenreichen, also besuchenswerten Landkreisen ihre imaginären Grenzen quasi dichtgemacht, indem sie Ausflügler aus dem Großraum München durch  aggressive Aufschriften („Verpisst euch“), markige Aussprüche von Mandatsträgern („dahoam is aa schee“), Sperre oder Verteuerung von Parkplätzen und ähnliche eigenmächtige Maßnahmen immer mehr vergraulten. Münchner, so meldet der Münchner Merkur, seien geradezu „verhasst“ im Alpenvorland. Mancherorts mache man sich Sorgen um die „Tourismusgesinnung“, stellte die Süddeutsche Zeitung fest
aggressive Aufschriften („Verpisst euch“), markige Aussprüche von Mandatsträgern („dahoam is aa schee“), Sperre oder Verteuerung von Parkplätzen und ähnliche eigenmächtige Maßnahmen immer mehr vergraulten. Münchner, so meldet der Münchner Merkur, seien geradezu „verhasst“ im Alpenvorland. Mancherorts mache man sich Sorgen um die „Tourismusgesinnung“, stellte die Süddeutsche Zeitung fest
Die jedenfalls gespannte Lage hat die grüne Münchner Bürgermeisterin Karin Habenschaden dieser Tage zur Schadensbegrenzung gedrängt. In digitalen Gesprächen mit Bürgermeistern einiger Ausflugsgemeinden bemühte sie sich um einen Modus Vivendi. Wie ein erträgliches Zusammenleben unter Pandemie-Bedingungen genau aussehen soll, blieb offen. Offenbar sollen Apelle und Aufklärung in Stadt und Land vorerst genügen.
Zum Glück geben sich nicht alle Voralpenbewohner so ungastlich, respektive ängstlich wie manche Leute am Tegernsee, Schliersee, Spitzingsee und am Fuße der Zugspitze. Die noch geltende Ausgangsfreiheit nutzend, fuhr ich mit Alwine per Bahn eben noch mal nach Bad Tölz. Und siehe: Dort wurde uns vermummten Spaziergängern sogar ein freundliches „Grüß Gott“ zugerufen. Freilich bot die sonst so herrliche und jetzt menschenleere Marktstraße nicht gerade ein Bild urbanen Lebens. Die beim Bäcker eingekaufte Brotzeit mussten wir am Marktbrunnen stehend verzehren. Man sollte halt doch den Virologen und Politikern folgen und zu Hause bleiben. Bis bessere Zeiten kommen.
25. Januar 2021
Genau zwölf Monate sind nun vergangen, seit das neuartige Virus in Deutschland angekommen ist. In der Nacht auf Freitag den 25. Januar 2020 bekam der 33 Jahre alte Chrisoph N. Schüttelfrost und Halsweh. Gliederschmerzen, Fieber und Husten folgten. Der leitende Angestellte des Autozulieferbetriebs Webasto in Stockdorf bei Gauting vermutete eine Erkältung. Er konsultierte seinen Hausarzt. Der erkannte, dass es sich nicht nur um einen grippalen Infekt handeln konnte und schickte N. ins Tropeninstitut der Universität München.
Das Ergebnis des Rachenabstrichs erfuhr N. zu Hause in Kaufering am Telefon: Er war infiziert von einem in China grassierenden Erreger, den die WHO wegen seiner Zacken als „Corona“ (Krone) bezeichnete. Umstände und Verbreitung der Ansteckung wurden schnell geklärt: Am 20. und 21. Januar hatte N. Besprechungen mit einer aus Shanghai eingeflogenen Kollegin vom Zweigwerk in Wuhan. Nach ihrer Heimkehr wurde die Chinesin am 26. Januar ebenfalls positiv getestet. Christoph N. und neun weitere infizierte Webasto-Mitarbeiter sind binnen zwei Wochen wieder genesen.
Die nun fällige Jahresbilanz ist verheerend: Bis zum heutigen Tag meldet das Robert Koch-Institut für Deutschland insgesamt 2 141 665 Fälle von Virus SARS-CoV-2-IInfektion, davon 1 807 500 Genesene, 52 097 Tote, 4768 Intensivpatienten, 1 632 777 Geimpfte, 111 Neuinfekte in sieben Tagen (Inzidenz), 1.01 Neuansteckungen pro infizierter Person (Reproduktionszahl). Bayern liegt bei den Bundesländern nach wie vor an zweiter Stelle mit 39 985 Infizierten und 9640 Toten. Allerdings: seit einigen Tagen zeigt sich ein Lichtschimmer am Ende des Tunnels. „Die Zahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, sind aber immer noch auf zu hohem Niveau“, fasste Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zusammen.
Die Bilanzierung veranlasste mich, Vergleichszahlen für China zu recherchieren. Merkwürdigerweise bleibt der aktuelle Stand im Ursprungsland der Pandemie in den Übersichten der Medien so gut wie unerwähnt. Dabei genügt ein Blick ins Netz, um erstaunliche Statistiken zu finden: Wurden bis zum 4. März 2020 noch täglich weit über hundert Neuinfizierte gezählt, so blieb deren Zahl seither unter zwanzig pro Tag. Insgesamt meldet China seit Ausbruch der Seuche 89 439 Infizierte, von denen 82 211 genesen seien. Die Zahl der Todesfälle wird in China mit 4624 beziffert - weltweit mit über einer Million. China hat 1,4 Milliarden Einwohner.
Diese Zahlen stammen von der Weltgesundheitsorganisation, welcher – besonders von Donald Trump – eine gewisse Abhängigkeit von Peking unterstellt wurde. Dem wäre zu entgegnen, dass es auch in einem autoritär regierten Land kaum möglich wäre, wesentlich höhere Zahlen an Erkrankungen und Toten längere Zeit geheim zu halten. Eingedämmt wurde Corona in der Volksrepublik offenbar beizeiten durch Maßnahmen, wie sie in demokratischen Ländern wohl kaum nachvollziehbar wären. Staatsführer Xi Jinping sprach von einem „Volkskrieg gegen das Virus“. Über die ganze Provinz Hubei wurde Quarantäne verhängt, über 42 000 Ärzte und Pflegekräfte wurden dorthin beordert. Unverzüglich und überall wurden Vergnügungsstätten geschlossen, Schulferien verlängert, Grenzen gesperrt, Körpertemperaturen gemessen. Nach einem erneuten Ausbruch wird die Volksgesundheit noch schärfer überwacht; durch Smartphone-Apps, die für verschiedene Lebensbereiche entwickelt wurden, durch Drohnen, die Menschen ohne Masken melden, und durch Hausarrest für 23 Millionen Stadtbewohner.
In einer parlamentarischen Demokratie unmöglich? Nun, auch das lässt sich dem Netz entnehmen: Der freiheitliche, von China beanspruchte Inselstaat Taiwan hat die Seuche ebenfalls unter Kontrolle bringen können durch frühzeitige systematische Eingriffe des nationalen Krisenzentrums - und ganz ohne Lockdown. Seit dem 1. April 2020 sind insgesamt weniger als 600 der 23 Millionen Staatsbürger durch das Virus SARS-CoV-2 angesteckt und nur noch zwei Menschen an oder mit Corona gestorben.
Ein Jahr Corona: Der Gedenktag in Deutschland bietet auch Gelegenheit, hundert Jahre zurückzuschauen. Anfang 1921 war die dritte und letzte Welle der sogenannten Spanischen Grippe verebbt. Die am Ende des Ersten Weltkriegs aus Amerika eingeschleppte Seuche hat weltweit 50 Millionen und allein in Bayern etwa 30 000 Menschen das Leben gekostet. Weithin fehlten Ärzte und pflegendes Personal, so dass heimgekehrte Soldaten in die Lazarette geschickt werden mussten. Eine Impfung gab es noch nicht. Ärzte empfahlen tiefes Atmen in frischer Luft und das Vermeiden von Überarbeitung.
1. Februar 2021
„Hurra, die Schule brennt“. So hieß mal ein dummer Film. Überhaupt hatte man früher den Eindruck, dass „Pennäler“ nichts lieber täten als Ferien und andere Ausfälle des ach so langweiligen Unterrichts feiern. Damals waren ja Begriffe wie Homeschooling und Distanzunterricht völlig unbekannt. Jetzt aber scheinen allesamt – Schüler, Eltern, Lehrer, Politiker und Verbandsfunktionäre - geradezu begierig zu sein, dass möglichst bald alle Jugendlichen wieder brav und regulär „die Schulbank drücken“, wie es so schön heißt. Genau das ist infolge der Pandemie zu einem pädagogischen Problem erster Klasse geworden.
Verschlossene Schultore und laufend neue, halbherzige Regelungen haben zu einer gewissen Verunsicherung beigetragen. Der anhaltend fehlende Direktkontakt zur Lehrkraft und zu Klassenfreunden vereinsamt vor allem die jüngeren Schüler, während Defizite beim digitalen Abarbeiten der Fächer mehr die älteren betrifft. Längst nicht überall stehen Lehrern und Schülern elektronische Kommunikationsmittel ausreichend zur Verfügung, längst nicht alle können umgehen mit Computer, Laptop, Smartphone und WLAN.
„Ein grandioses Durcheinander und zum Teil blanke Ohnmacht.“ So klagt Bernd Siggelkow, der Gründer des christlichen Jugendhilfswerk "Die Arche", das sich besonders um Schüler aus ärmeren Familien kümmert. Viele befürchten eine Zunahme von Analphabeten und Bildungsrückstände für die ohnehin Benachteiligten. Bröckeln die Bildungschancen für eine ganze Generation?
An der Technologie scheint die „neue Schule“ jedenfalls nicht zu kranken, an gutem Willen und Hilfe durch Staat und Stadt auch nicht. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) erhofft zum 14. Februar wieder Präsenz-Unterricht, mindestens für die Jüngeren, falls es das „Infektionsgeschehen“ erlaube. Und in München sind bereits alle Berufsschulen, Gymnasien und Realschulen sowie 92 Prozent der Grund- und Mittelschulstandorte „breitbandig angebunden“, so dass sie somit grundsätzlich über die technischen Voraussetzungen für den Distanzunterricht verfügten, antwortete das Stadtreferat Bildung und Sport auf eine Anfrage der Freien Wähler.
Dass fundierte Digitalschule möglich ist, bestätigte mir Marion Schüle, die im vergleichsweisen wohlhabenden Ingolstadt an kirchlichen Lehranstalten unterrichtet. Mit Hilfe der digitalen Medien kann sie sich mit ihren elf- bis 15-jährigen Realschülern tadellos verständigen, alle seien entsprechend ausgerüstet und gern bei der Sache. Meist hat die Lehrerin - ihr Mann ist als IT-Experte hilfreich - alle komplett auf ihrem Großmonitor. Bilder und sonstiges Lehrmaterial kann sie per Power Point präsentieren und diskutieren. Nur der persönliche Kontakt, der fehlt halt. Und das ist das Hauptproblem beim Distanzunterricht. Längst nicht alle Eltern sind als Lehrerersatz geeignet, im Homeoffice schon gar nicht.
Zum Vergleich ein Blick zurück in meine eigene Schulendzeit. Im Winter 1946/47 mussten wir 18-jährigen Gymnasiasten fürs Abitur pauken. Wir froren arg. Draußen war das Thermometer auf bis zu 19 Minusgrade gefallen und die Kohlentransporte aus dem Ruhrgebiet blieben aus. Auch waren einige Nazi-Lehrer weg. Hunger und Kälte ließen Erkrankungszahlen steigen. Immer wieder fiel der Unterricht aus oder wurde auf eine Stunde täglich begrenzt.
In unserer primitiven Schülerzeitung „Der Funke“ verabschiedeten wir uns von der – wiederholt ausgebombten - Anstalt mit einer etwas pathetischen Prognose: „Viel Mühe wird uns begleiten, viel Leid sich in unsere Seelen eingraben. Der Alltag mit seinen Sorgen und Entbehrungen wird uns gefangen nehmen …“ Dennoch gaben wir diesem Leitartikel vom 9. Januar 1947 einen trotzigen Titel: „Wir haben eine Hoffnung.“
8. Februar 2021
Hurra, ich bin dran. „Sie können jetzt Ihre Termine zur Corona-Impfung vereinbaren“, teilt das Impfzentrum München per E-Mail mit. Erst klappt es gar nicht, denn ich soll einen Code eingeben; den hat man mir ans Smartphone gesendet, das aber seit Dezember in Reparatur ist und nicht ausgeliefert werden darf. Als ich alternativ die Mobilnummer meiner Enkelin online melde, bekomme ich den ersten Termin schon zum nächsten Tag, 16.15 Uhr. Bestimmte Dokumente soll man mitbringen und pünktlich soll man sein, denn „wegen der sehr kurzen Haltbarkeit nach Auftauen wird der Impfstoff bei kurzfristiger Absage oder Nichterscheinen möglicherweise verfallen“.
Das Impfzentrum ist die große Halle C, weit draußen in der Messestadt. Sie war letztmals vor einem Jahr genutzt worden: mit der Messe „free“, die für weltweiten Tourismus warb. Am Eingang deutet sich Chaos an: Pausenlos kommen Menschen zu Fuß, mit Rollator – und in Rollstühlen, die hier auch verliehen werden. Sie suchen rum. Sitzgelegenheiten werden angeboten. Privatautos, Pendelbusse, Sanitätswagen fahren vor. Die meisten Impfterminierten gehören der zeitlich bevorzugten Gruppe der über 80-Jährigen an. Doch auch Jüngere reihen sich in die Schlange; sie sind Betreuer der Alten oder frei tätige Angehörige von Rettungs- und Pflegediensten. Einige Gewitzte versuchen (vergeblich), auch ohne Termin an die rettende Spritze zu gelangen.
Die uniformierten Helfer, knapp hundert sollen es insgesamt sein, lassen die Wartenden im Viertelstundentakt in die Halle. Sie alle sind erfüllt von Höflichkeit und Hilfsbereitschaft. Einer verrät mir: „Heute ist der erste Tag im Vollbetrieb.“ Dieser Betrieb läuft ab jetzt wie am Schnürchen, ist ja lange und mit bayerisch-deutscher Gründlichkeit vorbereitet worden. Etwa 1600 Leute sollen in den acht Stunden am Samstag geimpft werden.
Noch ein paar Infoschalter, Sperren, Fragen, Auskünfte, fast wie früher auf dem Flughafen, der jetzt so leer ist. Ich lande in Koje C 13, werde von einer  Ärztin und einem Sanitäter freundlich begrüßt und nochmal ein bisschen nach Vorerkrankungen befragt. Als ich melde, dass ich vor vielen Jahren in der Wüste von Arizona über Nacht eine schwere allergische Reaktion bekommen hatte, die mich ins Krankenhaus von Phönix zwang, sagt die Ärztin, es sei nicht auszuschließen, dass gleich nach der Impfung ein anaphylaktischer Schock aufträte. Doch im Ruheraum, wo ich wie alle anderen frisch Geimpften noch eine halbe Stunde sitzen muss, löst sich der Schock in nichts auf. Neben mir scherzt ein 95-Jähriger: „Jetz werd i glei no älter.“ Die Stimmung lockert sich.
Ärztin und einem Sanitäter freundlich begrüßt und nochmal ein bisschen nach Vorerkrankungen befragt. Als ich melde, dass ich vor vielen Jahren in der Wüste von Arizona über Nacht eine schwere allergische Reaktion bekommen hatte, die mich ins Krankenhaus von Phönix zwang, sagt die Ärztin, es sei nicht auszuschließen, dass gleich nach der Impfung ein anaphylaktischer Schock aufträte. Doch im Ruheraum, wo ich wie alle anderen frisch Geimpften noch eine halbe Stunde sitzen muss, löst sich der Schock in nichts auf. Neben mir scherzt ein 95-Jähriger: „Jetz werd i glei no älter.“ Die Stimmung lockert sich.
Daheim empfängt mich die frohe Botschaft eines Reiseveranstalters: „Ob ein Badeurlaub in Kroatien, eine Mittelmeerkreuzfahrt oder bereits Vorfreude auf Silvester – für jeden Geschmack ist etwas dabei.“ Das Leben geht weiter, vielleicht bald wieder so normal wie gehabt. Und dann kommen im Fernsehen auch noch die Franken mit ihrer unverwüstlichen Fastnachts-Show in Veitshöchheim. Allerdings: Das kostümierte Publikum besteht aus ein paar Statisten im Sicherheitsabstand, die sonst so gern angepflaumten Politiker aus Pappköpfen und der Tusch kommt aus der „Duschmaschin“. Aber die Witze, Songs und Elegien zum Thema Corona sind erste Ware.
In Altbayern hingegen nähert sich der Höhepunkt des Faschings eher verhalten und geräuschlos. Eigentlich müsste es jetzt hoch hergehen. Nach Starkbierzeit und Wiesn entfällt nun auch diese Gaudi, die den Corona-Gefangenen ein Ventil. hätte bieten können. Ganz will die offizielle Narrhalla aber doch nicht verzichten, sie hat einfach, wie so viele Kulturträger, auf online umgeschaltet: Die meisten der planmäßigen Veranstaltungen, von der Inthronisation des Prinzenpaares bis zum „Schlagerfasching“ am unsinnigen Donnerstag, wurden und werden per Live-Stream dargeboten, natürlich ohne eigentliches Publikum. Und einige „verdiente“ Mitbürger sowie 2000 Seniorinnen und Senioren bekommen einen vom Karikaturisten Dieter Hanitzsch entworfenen Orden mit maskiertem Münchner Kindl. Dabei ist Münchens Faschingsgeschichte doch eng mit dem Seuchengeschehen verbunden. Die Legende führt nämlich den alle sieben Jahre fälligen Schäfflertanz auf die Pest zurück. Im Jahr 1517 soll der „Schwarze Tod“ dermaßen gewütet haben, dass die meisten Ratsleute aus der Stadt geflohen seien und die meisten Bürger in ihren Häusern blieben, was eine gewaltige Hungersnot zur Folge gehabt haben soll. Als die Seuche endlich abflaute, habe ein mutiger Mann aus der Zunft der Schäffler seine Wohnung im Färbergraben verlassen und Kollegen animiert, die Bürger durch Musik und lustiges Spiel aufzuheitern. Leider tanzen die Schäffler heuer nicht.
15. Februar 2021
Jetzt wird er ja doch ein bisschen gelockert, der Lockdown. Wenn man das Furcht erregende Wort in der angewöhnten Mischsprache Denglisch übersetzt, könnte es auch heißen: Runter mit den Locken! Ja, die Friseure sind systemrelevant geworden, sie dürfen uns ab 1. März wieder mit Kamm, Schere und allerlei Wässerchen verschönern. Da bin ich aber froh. Zwei Monate lang habe ich Meister Martin fast schmerzlich vermisst. Das erkennt man am Haupthaar. Um es etwas zu lichten, bin ich mehrmals mit dem Elektrorasierer reingefahren. Gut, als Mann ist man diesbezüglich nicht gar so eitel. Wie aber haben die anspruchsvolleren Damen ihre Lockenpracht über den Lockdown gerettet? Liegt es nur an der Kälte, dass so viele Frauen ihre Schöpfe derzeit mit Hüten bedecken?
Während etwa 240 00 Hair-Stylisten und Beauty-Saloons der Republik (8000 sind es in München) dank politischem Beschluss wieder das Schild „Open“ aushängen dürfen und dies einen sonderbaren Medienwirbel auslöst, raufen sich viele andere ausgesperrte Handwerker und Händler die Haare. Immer mehr Lobbyisten reihen sich in die Schlange an der Corona-Klagemauer. Sie harren einer magischen, von der Kanzlerin höchst selbst vorgegebenen Zahl: 35. Erst dort, wo diese Inzidenzgrenze zwei Wochen lang gehalten wird, darf weiter gelockert werden. Worauf einige Branchen bis an den Rand der Verzweiflung harren.
Zum Beispiel die den Haarschneidern verwandten Kosmetikerinnen. Für sie scheint die Mahnung von Markus Söder, gepflegtes Äußeres sei „eine Sache der Würde“, noch nicht zu gelten. Da müssen halt die Kundinnen noch eine Inzidenz-Periode länger warten, bis ihre Nägel wieder gekürzt und ihre Wimpern wieder verlängert werden von fachkundigem Händen. Oder die Blumenhändler, denen die nach wie vor geöffneten Supermärkte das Geschäft klauen. Einige Floristen haben nun am Valentinstag, ihrem wichtigsten Geschäftstag neben den großen Feiertagen, per „Click and Collect“ ein paar Blumengebinde verkaufen können.
Allzu arg gebeutelt fühlen sich auch die Textilhändler. Ihre Ware ist ja der stets wechselnden Mode und jahreszeitlichen Gegebenheiten unterworfen, ihr Geschäft desgleichen. Mindestens zwei renommierte Münchner Modekonzerne melden einige Misere: Willy Bogner, spezialisiert auf Sportbekleidung, muss seine Firmenzentrale verkaufen. Bei Lodenfrey, eher spezialisiert auf Tracht, sind 70 Prozent des Vorjahrsumsatzes weggebrochen, weil halt auch das Oktoberfest, kleinere Feste und sogar Hochzeiten ausgefallen sind.
Um ihre Existenz bangen auch die Fahrlehrer. Seit 9. Dezember, als die Münchner Inzidenz auf 200 geklettert war, dürfen sie keinen Fahrunterricht mehr erteilen, auch nicht digital wie die Schulen, das würde ihr Verband nicht erlauben. Da somit auch keine Führerscheine mehr erteilt werden, ergibt sich die eher positive Tendenz, dass die Zahl der Autofahrer im längst überlasteten Stadtverkehr vorerst stagniert. Steigen also noch mehr Münchner – trotz Kälte und Schnee – aufs umweltfreundliche Radl um? Schön wär’s, doch auch ihnen droht der Corona-Wahn. Die CSU-Fraktion im Rathaus möchte nämlich das Radeln auf den Hauptwegen des Westparks verbieten lassen, weil sie Aerosole auswerfen und somit Spaziergänger gefährden könnten.
So leiden wir leider alle an diesem verdammten Lockdown, der eine mehr, der andere weniger.
22. Februar 2021
Die größte Lehranstalt Deutschlands ist gähnend leer. Seit 15. Dezember 2020 ist die Münchner Universität außer Betrieb. Zettel an den Zugangstüren geben lapidar bekannt: „Die Gebäude der LMU sind derzeit geschlossen Wir bitten hierfür um Verständnis.“ Nicht anders sieht es bei den übrigen 14 Hochschulen der Kulturstadt München aus. Ganze Viertel in der Maxvorstadt samt ihren Kneipen und Szenetreffs sind derzeit verödet. 131 000 für das Wintersemester immatrikulierte Studenten sitzen daheim und versuchen, den Lehrstoff „auf Distanz“ zu bearbeiten.
Dass Hochschulen hierzulande auf Staatsgeheiß lahmgelegt werden, ist historisch gesehen, nichts Neues. Wenn auch freilich aus anderen Gründen. Im März 1848 hatte König Ludwig I. gedroht, die von ihm 1826 aus Landshut nach München geholte Landesuniversität – sie ist heute nach ihm und seinem Sohn Maximilian benannt - zu schließen, weil ihn die (nur männlichen) Studiosi wegen seiner Liebelei mit Lola Montez verspotteten. Im Januar 1943 drohte  ein Nazi-Gauleiter, die Hochburg der Bildung zu schleifen, weil ihn die Kriegsversehrten und jungen Frauen, die in jenem Kriegsjahr noch studieren durften, wegen Unflätigkeit gegen Studentinnen ausgebuht hatten. Und im Februar 1969 schloss ein CSU-Kultusminister die Kunstakademie wegen „obszöner“ und sonst wie störender Umtriebe.
ein Nazi-Gauleiter, die Hochburg der Bildung zu schleifen, weil ihn die Kriegsversehrten und jungen Frauen, die in jenem Kriegsjahr noch studieren durften, wegen Unflätigkeit gegen Studentinnen ausgebuht hatten. Und im Februar 1969 schloss ein CSU-Kultusminister die Kunstakademie wegen „obszöner“ und sonst wie störender Umtriebe.
Jetzt hat eine Seuche das bayerische Hochschulwesen nahezu stillgelegt. Mehr als 400 000 junge Frauen und Männer (so viele waren noch nie für ein Semester eingeschrieben) könnten dem eigentlich abgedroschenen Klagelied vom deutschen Bildungsnotstand eine neue Strophe hinzufügen. Ein Lied von freier Lehre. Ist das die Freiheit, die sie meinen?
Wie geht’s den Studierenden? „Mir fehlt besonders der direkte Kontakt mit den Kommilitonen“, sagt Nachbar Uli, der wenigstens in seiner WG etwas Geselligkeit findet. Aber als Architektur-Student müsste man sich eigentlich öfter persönlich austauschen, etwa über aktuelle Projekte, Modelle oder Materialien. Nur vier Workshops konnte er machen, mindestens 20 wären es sonst. Die wenigen Vorlesungen an der Technischen Universitzt finden digital statt. „Der Durst wird immer größer“, sagt er. Immerhin ist er durch Gelegenheitsarbeit in Museen wirtschaftlich ziemlich abgesichert.
Viele junge Akademiker jedoch hat der Lockdown in existenzielle Not getrieben. Manche mussten bereits das Studium abbrechen, weil der elterliche Zuschuss versiegt und für die hohen Münchner Mieten (durchschnittlich 724 Euro) nicht mehr reicht. Zahllose 400-Euro-Jobs sind weggebrochen, hauptsächlich in der Gastronomie; ein einziger Münchner Club musste 40 Studentinnen freistellen. Das Studentenwerk hat seinen Beratungsdienst auf 21 Mitarbeiter aufgestockt. Eine „Nightline“ (98 3571 3572) hilft sogar nachts. „Auf die Dauer werden psychische Schäden wohl kaum ausbleiben,“ befürchtet der Student.
Leer sind die gläsernen Litfaßsäulen in der LMU, wo früher zahlreiche Veranstaltungen angezeigt wurden. Gerade mal ein Termin war bis eben angekündigt: Am 18. Februar hielt Pfarrer Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, eine Vorlesung zur aktuellen Frage: „Warum Kirche zu Menschenfeindlichkeit nicht schweigen kann“. Eine Video-Veranstaltung, die wegen der Versammlungsunfreiheit nicht live besucht werden konnte, aber online hier abrufbar ist. Sie gilt dem Gedächtnis der „Weißen Rose“.
Die so genannte „Denk-Stätte Weiße Rose“ neben dem LMU-Lichthof, dem zentralen Ort des mutigen studentischen Widerstands im Februar 1943, ist natürlich auch geschlossen. Vor dem Uni-Hauptgebäude jedoch sind die auf Keramikplatten kopierten, wie ausgestreut wirkenden Flugblätter nach wie vor zu sehen. Vielleicht sollte jene lautstarke „Quer-Vordenkerin“, die sich, wissenschaftlichen Erkenntnissen misstrauend, in ihrem totalen wirren Freiheitsdrang frecherweise auf Sophie Scholl berief, mal einen Blick darauf werfen. Zitat aus Flugblatt Nr. VI: „Es geht uns um unsere Wissenschaft und um wahre Geistesfreiheit ..."
1. März 2021
Der allzu lange Lockdown wird gelockert. Allerdings nur in ganz kleinen Schritten, wie es in einer einst viel gesungenen Polonaise heißt. Jetzt sind also die Friseure dran; auf einen Termin muss ich freilich noch zwei Wochen warten. Öffnen dürfen – natürlich nur mit perfekten Hygiene-Konzepten – auch wieder die Kosmetiksalons und sonstige „körpernahe Dienstleistungen“ wie Physiotherapeuten, Maniküre- und Nagelstudios sowie Baumärkte und Gärtnereien. Hier könnten die Leute fürs Frühjahrswerkeln Haus und Garten vorsorgen, betonte ein Verbandsfunktionär den gesundheitlichen Sinn dieser Ausnahme. Ja, da kommt Freude auf.
Auch Musik- und Singschulen dürfen ab sofort wieder Unterricht erteilen. Allerdings nur dort, wo die Inzidenz unter 100 liegt. Und nur für Solisten, nicht für Chöre, denn nach physikalischem Befund können gefährliche Aerosole mit voller Lunge fünf Meter weit ausgestoßen werden. Noch nicht geklärt ist, inwieweit beim Üben mit Instrumenten eine Maske getragen werden muss.
In München treten Laienchöre immer wieder vor Seniorenheimen auf, während Liedermacher wie beispielsweise der Giesinger "Hundling" auf der Straße vor Obdachlosen singen. Dergleichen Initiativen erinnern mich an das im Hungerherbst 1946 sehr erfolgreiche Theaterstück „Nun singen sie wieder“; der Schweizer Autor Max Frisch meinte das symbolische Wiedererscheinen von Kriegsopfern, nicht etwa von Corona-Geschädigten.
Einige Veranstalter von Festivals, Musikverlage, Agenturen, Instrumenten-Hersteller und Musikalien-Händler erwägen jetzt, vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eine „vorsichtige“ Öffnung von Musikbühnen einzuklagen; sie stützen sich auf ein von der Bayerischen Staatsoper erarbeitetes Sicherheitskonzept, das von Kulturpolitiker*innen und Prominenten wie Anne-Sophie Mutter unterstützt wird.
Ein vergleichsweiser großer Schritt auf dem Weg zurück zur „neuen” Realität war die Wiederöffnung von Grundschulen durch einen moderaten Präsenzunterricht. Doch schon nach wenigen Tagen zeigte sich, dass die elf Wochen Zwangspause respektive Distanz- oder Wechselunterricht, wobei die Kinder eher ihre Freunde als ihre Lehrer vermissten, eine Fülle von Problemen hinterlassen haben, über deren Lösung nunmehr in Ministerien, Stadtbehörden, zuständigen Verbänden und psycho-soziologischen Instituten heftig nachgedacht wird. Darüber will ich mir beizeiten auch nochmal Gedanken machen.
8. März 2021
Immer noch sind uns andere Länder so gut wie versperrt. Dann wollen wir wenigstens mal aufbrechen in ein anderes Bundesland. Als gefühlter Ersatz für die Welt da draußen bietet sich die nächstgelegene Stadt jenseits der weiß-blauen Grenzpfähle an: Ulm. Also nichts wie raus, wie der aktuelle Schlachtruf lautet, und im leeren Zug dorthin.
Auch durch Württemberg fegt ein eisiger Wind von Nordost. Schnell durch das nagelneue, kurz vor Fertigstellung stehende Bahnhofsviertel, rüber zum Münster. Im größten Kirchenbau Süddeutschlands empfangen uns fromme Sprüche zum Prinzip Hoffnung. Anschließend mit dem Bus hinauf zur Wissenschaftsstadt und durch den Wald zum Eselsberg. Im Süden verschwimmt der höchste Kirchturm der Welt im Sonnendunst. Zum Stehkaffee im Freien ist es trotzdem zu kalt.
Später Lunch im Hauptbahnhof, zu dessen Halle man sich – ähnlich wie in München – nur über eine riesige Baustelle durchschlägt. Man ergattert einen der Gittersessel, die im gebotenen Abstand montiert sind, stellt den  Pappbecher auf den Steinboden und beißt in das angewärmte Stück Flammkuchen. Eilig Reisende umdrängen die eilig Essenden, denen die Schutzmasken zwischen den Ohren baumeln. Das Ulmer Bahnhofsrestaurant hatte mal einen tollen Ruf. Heimwärts wieder im nicht mehr ganz so leeren Zug.
Pappbecher auf den Steinboden und beißt in das angewärmte Stück Flammkuchen. Eilig Reisende umdrängen die eilig Essenden, denen die Schutzmasken zwischen den Ohren baumeln. Das Ulmer Bahnhofsrestaurant hatte mal einen tollen Ruf. Heimwärts wieder im nicht mehr ganz so leeren Zug.
Ende eines Sonntagsausflugs im zweiten Corona-Jahr. Und weiter warten, weiter hoffen auf richtige Reisen. Sie sind das, was ich zurzeit am meisten vermisse – nach offenen Restaurants und Biergärten, bespielten Bühnen, Bibliotheken und Buchläden.
Am Tag vor Ulm war ich in Riem, zur zweiten Impfung. Kein Warten mehr, keine Nebenwirkungen. Ich müsste jetzt also immun sein. Doch eine Frage quält mich noch: Könnte ich ein eventuell eingefangenes Virus an eine andere Person weitergeben? Ich frage den Infektiologen Christoph Spinner vom Klinikum Rechs der Isar. Er klärt mich auf: „Für die Ermittlung der Infektiosität nach der Impfung müssten Geimpfte anlasslos regelmäßig auf SARS-CoV-2 mittels Antikörpertest kontrolliert oder gezielt einer Exposition ausgesetzt werden. In UK wird derartiges geplant.“ Alternativ könnten vorhandene Studiendaten dahingehend untersucht werden (in allen Impfstudien erfolgen gelegentlich anlasslose PCR Untersuchungen). Jetzt kann ich nur noch warten, bis die eher unethischen britischen Forscher vielleicht Genaueres bekanntgeben.
15. März 2021
Genau seit einem Jahr arbeitet meine Nichte im Homeoffice. Von ihrer Wohnung in Landstetten aus beliefert Angelika das Statistische Amt in der Münchner Schwanthalerstraße mit Zahlenreihen, Kurven und anderen Basisdaten. Das hatte die Stadt damals durch eine „Dienstanweisung Corona“ ihren Mitarbeitern anheimgestellt. Eigentlich wollte Angelika zu dieser Zeit in Amerika sein; jetzt kämpft sie immer noch um Rückerstattung der bezahlten Reisegelder.
Die Umstellung auf eine völlig andere Arbeitsweise wäre nicht möglich gewesen ohne eiserne Disziplin. Jeden Werktag um 7.30 Uhr setzt sich die „Fern-Schreiberin“ an den Laptop, der mit einer speziellen Software ausgerüstet ist. Um 13 Uhr ist Home-Cooking, meist ein schneller Salatsnack, Feierabend ist in der Regel um 16.30 Uhr. Danach geht die  Heimarbeiterin oft noch zur Physiotherapie, um sich nach dem langen Sitzen aufzulockern. Ab und zu schaut Ehemann Peter rein. Immer aber umschleichen die beiden Hauskatzen den Monitor oder schlummern davor ein.
Heimarbeiterin oft noch zur Physiotherapie, um sich nach dem langen Sitzen aufzulockern. Ab und zu schaut Ehemann Peter rein. Immer aber umschleichen die beiden Hauskatzen den Monitor oder schlummern davor ein.
Alles in allem ist Angelika mehr als zufrieden: „Ich finde das Homeoffice klasse, denn es erspart mir die Fahrzeit. Da ich aus einem weiter entfernten Landkreis komme, bin ich auch einer geringeren Ansteckungsgefahr ausgesetzt.“ Die Nähe ihrer Kolleg*innen, die allerdings vermisst sie schon sehr. Deshalb ist sie jedes Mal froh, wenn sie ab und zu ins Amt kommt, um dienstliche Termine vor Ort wahrzunehmen. Etwas anders dürfte es aber wohl dort ablaufen, wo Homeworker nicht durch Cats, sondern von Kids belagert wird.
Längst nicht alle kommen mit dem Homeoffice klar. Trotzdem scheint diese Art Büroarbeit allmählich zum neuen Standard zu werden. Immerhin erledigen bereits 60 Prozent aller Angestellten der Landeshauptstadt ihren Dienst von der Privatwohnung aus. Video- und Telefonschalten ersetzen gewohnte Konferenzen. Ausgereifte elektronische Systeme ermöglichen einen fast reibungslosen Betrieb. Über solche Programme melden sich täglich etwa 15 000 städtische Mitarbeiter an. Münchens Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) erwartet sogar, durch die künftige digitale Arbeitswelt einiges an Bürofläche und Miete einsparen zu können. Eine Frage von sozialpolitischer Relevanz: Wird Homeoffice auch Arbeitsplätze kosten?
Als freier Journalist bin ich an das berufliche Dahoam gewöhnt
Homeoffice verändert nicht zuletzt meinen Beruf. Zwar bin ich, wie die meisten freien Journalisten, seit langer Zeit an das berufliche Dahoam gewöhnt, an Schreibtisch, Computer und Telefon. Seit einem Jahr jedoch steigt der Anteil der Heimarbeiter unter den Kollegen stark. Daraus ergeben sich neuartige und gravierende Probleme. Der Bayerische Journalistenverband (BJV) bietet deshalb hilfreiche Online-Vorträge und -Fragestunden an. Dieser Tage informierte zum Beispiel ein renommierter Rückenspezialist über Wirbelsäulen- und Bandscheibenbeschwerden, denn die haben sich deutlich vermehrt.
Auch auffallend viele psychische Auswirkungen bei seinen Mitgliedern meldet unsere Gewerkschaft – andere Berufsgruppen sind ebenso betroffen. Da es kaum noch eine klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben gebe, falle es schwer, einen geregelten Tagesablauf einzuhalten, wenn man nicht das Haus verlassen müsse. Mancher habe trotz mehrerer Zoom-Konferenzen am Tag nicht wirklich das Gefühl, etwas geleistet zu haben, so der BJV und fragt per Rundschreiben: Warum ist das so? Warum meistern manche Menschen die Situation im Homeoffice besser als andere?
"Die im Januar beschlossene Pflicht der Firmen zum Homeoffice, um die Corona-Ansteckungen zu verringern, ist bislang zum Teil verpufft“, stellte das Münchner Ifo-Institut fest. Das Potenzial für Homeoffice sei noch keinesfalls ausgeschöpft. Rund 39 Prozent der befragten Deutschen gaben an, grundsätzlich könnten sie ihren Beruf uneingeschränkt oder großenteils in Heimarbeit ausüben. Tatsächlich erledigten im Januar weniger als ein Viertel aller Beschäftigen ihre berufliche Arbeit von Zuhause aus. Im November 2020 waren es erst 14 und im Dezember 17 Prozent. Tendenz steigend.
22. März 2021
Guten Mutes rollert Lucie jeden Morgen von Berg am Laim nach Haidhausen. Nach drei Monaten Wechsel- oder Garnicht-Unterricht ist die Neunjährige richtig froh, wieder regelmäßig in die Schule gehen und ihre Freunde  sehen zu dürfen. Vor dem Virus hat sie kein bisschen Angst: „Wir haben ja immer, auch in der Pause, die Maske an.“ Trotzdem war ein Bub schon mal infiziert. Nach dem Positiv-Test mussten alle 23 Kinder der vierten Grundschulklasse in Quarantäne, sieben Tage hatten sie praktisch Stubenarrest. Dank eigenem Tablet war das kluge Mädchen auch mit dem Distanzunterricht klargekommen. Ihre Lehrerin, meint Lucie, habe wohl mehr Angst als sie. Und ihre Oma sei im ersten Lockdown richtig depressiv geworden „vor lauter Corona“.
sehen zu dürfen. Vor dem Virus hat sie kein bisschen Angst: „Wir haben ja immer, auch in der Pause, die Maske an.“ Trotzdem war ein Bub schon mal infiziert. Nach dem Positiv-Test mussten alle 23 Kinder der vierten Grundschulklasse in Quarantäne, sieben Tage hatten sie praktisch Stubenarrest. Dank eigenem Tablet war das kluge Mädchen auch mit dem Distanzunterricht klargekommen. Ihre Lehrerin, meint Lucie, habe wohl mehr Angst als sie. Und ihre Oma sei im ersten Lockdown richtig depressiv geworden „vor lauter Corona“.
Die im Dunkeln des neuen schulischen Alltags, die Kinder sozial benachteiligter Familien, sieht man eher nicht. Auf sie hat Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy jetzt den Blick gelenkt: "Nach einem Jahr Pandemie sehen wir eindeutig schwerwiegende Auswirkungen für Kinder und Jugendliche.“ Die Rückmeldungen der Kinderkliniken und Jugendpsychiatrie, der Kinderärzt*innen, Psychotherapeut*innen und operativen Jugendhilfen zeigten eine Zunahme von Angst- und Zwangsstörungen, Depressionen und Suizidgefährdungen. Auch Aggressionen unter den Jugendlichen stiegen auffallend. Und bei den Lehrern und Lehrerinnen wächst die Angst, beim wieder begonnenen Präsenzunterricht trotz aller Hygiene mutierte Viren einzufangen, weshalb die Verbände auf eine vorgezogene Impfung des Lehrpersonals drängen.
Die Seuche überfällt meinen kleinen Wanderverein
Vom Sterben muss auch noch die Rede sein. Plötzlich hat die weltweite Seuche meinen kleinen Wanderverein überfallen. Zwei Senioren, eine Frau und ein Mann, sind verstorben. „Beide hatten sich mit diesem scheußlichen Virus infiziert und konnten nicht gerettet werden“, entnehme ich einem traurigen Rundschreiben. Man möge sich bei der Friedhofsverwaltung erkundigen, ob die Teilnahme an der Beisetzung derzeit möglich sei. Durchhalten ist jedenfalls angesagt. RKI-Präsident Lothar Wieler spricht vom „letzten Drittel eines Marathonlaufs“, das bekanntlich besonders schwierig sei. Man kann eine Pandemie ja auch sportlich sehen.
Wie schön wäre es, wenn unser aller Leben nach und nach wieder ein wenig freier, sozusagen normaler würde. Aber Vorsicht: Nicht alle „Lockerungen“ machen wahr, was sie versprechen. Nicht selten sind sie mit so vielen Bedingungen verknüpft, dass man lieber ganz darauf verzichten möchte. Und andere schüren neue Ängste.
Am Wochenende durften wieder die ersten Charterflugzeuge nach Mallorca starten. 80 Prozent aller Osterreisen auf die Balearen sind schon gebucht, wie ein Großveranstalter melden kann. Das „Kleingedruckte“ klingt weniger anregend. Auf dem Flughafen hat jeder einreisende Urlauber ein kurzfristiges negatives Covid-Testergebnis vorzuweisen. An allen Stränden soll das Einhalten der Masken- und Abstandspflicht streng überwacht werden. Cafés und Restaurants müssen um 17 Uhr schließen. Der Alkoholausschank wird eingeschränkt. In Bussen gilt Sprechverbot.
Problematischer noch dürfte die Heimkehr von den Kurzferien sein. „Diese Mallorca-Urlauber befeuern die dritte Welle der Pandemie“, befürchtet der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Vielen Politikern, ebenso wie Ärzten und heimischen Touristikern wäre es lieber, wenn die Deutschen ihre seit Jahrzehnten „ungebrochene Reiselust“ vorerst in der schönen Heimat, möglichst im eigenen Bundesland, ausleben würden. Doch hier sind immer noch die Hotels und Gaststätten geschlossen – und obendrein viele Sehenswürdigkeiten und Vergnügungsstätten.
29. März 2021
Die „Osterruhe“ findet also nicht statt. Die Kanzlerin hat sich geirrt und für die auch von 16 Ministerpräsidenten gebilligte Idee entschuldigt. Die vom Lockdown nicht betroffenen Geschäfte dürfen also doch am Gründonnerstag und am Karsamstag öffnen. Jedoch bleibt eine seit langem kolportierte Horror-Vorstellung: dass unsere Innenstädte allmählich veröden. Wegen, aber nicht nur wegen Corona. München könnte einer der ersten Anwärter auf eine tote City sein.
Funktionäre des Einzelhandels rechnen damit, dass jedes zweite Geschäft infolge der Schließungen in absehbarer Zeit aufgeben werde, während sich der Onlinehandel noch brutaler als bisher ausdehnen dürfte. Das könnte – außer einem wirtschaftlichen und sozialen Rückschlag größter Art – eine gründliche Veränderung des Stadtbildes bedeuten. Eine Entwicklung übrigens, wie sie auch historische Seuchenzüge erzwungen haben: Nach der Pest wurden die  mittelalterlichen Gassen „begradigt“, Typhus und Cholera erforderten neuartige, oft unterirdische Infrastrukturen.
mittelalterlichen Gassen „begradigt“, Typhus und Cholera erforderten neuartige, oft unterirdische Infrastrukturen.
„Die Innenstädte von morgen und übermorgen werden anders aussehen als die von heute“, meint nicht nur Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ansätze dazu sind bereits zu erkennen. Traditionsreiche Kaufhäuser, Restaurants, Biergärten und Handelsketten haben Insolvenz angemeldet oder bereits definitiv geschlossen. Das ist die eine, die zunächst eher abschreckende Seite, wobei ein Verschwinden oder Auflockern von immer gleichen Kettenfilialen gar nicht so schlimm wäre.
Die Kehrseite lässt eine urbane Bereicherung erwarten. Kaum mehr wird bezweifelt, dass Corona auch die von vielen angestrebte Klima- und Verkehrswende vorantreiben könnte. So werden etwa geringere Schadstoffmengen in der Großstadtluft gemessen. Und schon scheinen sich der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad sowie die Planung von Radtrassen zu beschleunigen. Im April will München einige der im vorigen Jahr erprobten Pop-up-Radwege als dauerhafte Spuren einführen, weiß statt gelb bemalt. Und man will mit dem Landkreis im Herbst mit der „vertieften“ Planung von Radschnellverbindungen beginnen. Für den ersten Abschnitt vom Lenbachplatz bis zur Von-der-Tann-Straße sind die Planungen mittlerweile abgeschlossen.
Corona kann auch Bereicherung sein für den urbanen Raum
Das Referat für Stadtverbesserung hat indes in der Schwanthalerstraße, durch die sich massig Verkehr in die Innenstadt quält, eine neue Straßenaufteilung mit viel Grün und ganz wenigen Parkplätzen erprobt. Einen Tag lang eigneten sich unterschiedliche Initiativen und Privatpersonen den Straßenraum an und bespielten ihn als „alternatives Straßen-Layout“. Aus der Anwohnerschaft soll nun der Ruf aufgegriffen werden, „diese Intervention dauerhaft zu verstetigen“. Ein ähnliches Experiment sind heuer wieder autofreie „Sommerstraßen“.
Autofahrer werden wohl dauerhaft unter der Pandemie leiden müssen. Nicht nur aufgepoppte Radlwege und zeitlich strukturierte Fußgängerzonen kosten Parkplätze, sondern auch die aus Wien übernommenen Schanigärten. Etwa 900 Gaststätten hatten zwischen erstem und zweiten Lockdown solche „Vorgärten“ beantragt. 1037 Parkplätze fielen dafür weg. SPD und Grüne haben nun einen Antrag gestellt, diese „neuen Sitzbereiche“ auch nach der Corona-Pandemie zu erlauben.
Eine Bereicherung des Stadtbildes könnte auch die künftige Nutzung von Orten bringen, die für Zwecke des Testens und Impfens hergerichtet waren. Dazu gehören große Hallen und Grünflächen. Und natürlich die Theresienwiese, von der Frühlings- und Oktoberfeste und Tollwood-Festivals bis auf weiteres verbannt sind. Und Großdemos aller Art sind irgendwann hoffentlich nicht mehr nötig. Ein riesiger Parkplatz wie nach 1945 gehabt soll die gute alte Wiesn aber auch nicht werden. 42 Hektar – teils kümmerliches Grünland, teils hässlicher Asphalt – stünden zur Verfügung, damit wird spekuliert: für Sport und Kultur, für temporäre Veranstaltungen und natürlich für Erholung und seelische Aufrüstung nach dem so lange währenden Knock out.
Einen ansprechenden Vorschlag haben die Münchner Grünen schon mal präsentiert: Sie rollten eine sehr lange Fahne mit den Regenbogenfarben quer über das Spielfeld der großen Gaudi bis hin zur Paulskirche aus. Eine Botschaft der Hoffnung – und nichts für Querdenker.
6. April 2021
Der Glaube, die Hoffnung auf Auferstehung – nie zuvor waren diese großen Themen dringlicher als in Zeiten wie dieser. Um zu erleben, wie die Frohen Botschaften unter pandemischen Zwängen verkündet werden, fuhr ich am Ostersonntag mit Alwine in die Bischofsstadt Freising. Doch die Besteigung des Domberges erwies sich als voreilig. Ich hätte online buchen müssen, um zwei der auf 80 beschränkten Plätze für die Eucharistiefeier zu bekommen. Immerhin, nach dem Zwölfuhrgeläut stand das riesig schöne Gotteshaus für jeden offen.
Wie überall sonst, vom päpstlichen Rom bis zum gelobten Rostock, hat sich die Lage infolge des Lockdowns auch im religionsgeschichtlich so bedeutsamen Raum Freising verschärft. Auch nach den Ostertagen noch sind Katholiken wie Protestanten zum visuellen Kirchgang genötigt. In den meisten der 18 Bethäuser des Pfarrverbands wurden und werden Messfeiern „gestreamt“, dafür wurde ein eigener Youtube-Kanal eingerichtet. Überall wurden QR-Codes ausgelegt. An einigen Stationen der Kreuzwege können Videos geklickt werden.
Der digitalen Schule scheint nun also die digitale Kirche zu folgen. Eine Entwicklung, die vor allem ältere Gläubige wohl eher schockt als lockt. Das macht den Seelsorgern im „Bayerischen Rom“ zunehmend Sorge. „Wir verlieren  die Menschen und die Menschen verlieren uns“, befürchtet Stadtpfarrer Stephan Rauscher. Schließlich sei die Kirche kein Online-Anbieter, sie biete auch keine „Cyber-Religion“. Ähnlich wie Lehrer und Elternverbände drängen Kirchenvorstände und Pfarrgemeinden auf ein Festhalten am oder die Rückkehr zum echten „Präsenz-Gottesdienst“, soweit es die hygienischen Vorschriften zulassen.
die Menschen und die Menschen verlieren uns“, befürchtet Stadtpfarrer Stephan Rauscher. Schließlich sei die Kirche kein Online-Anbieter, sie biete auch keine „Cyber-Religion“. Ähnlich wie Lehrer und Elternverbände drängen Kirchenvorstände und Pfarrgemeinden auf ein Festhalten am oder die Rückkehr zum echten „Präsenz-Gottesdienst“, soweit es die hygienischen Vorschriften zulassen.
Ebenso findige wie fromme Freisinger haben inzwischen eine Kompromisslösung entwickelt, genannt Outdoor- oder Gartengottesdienste. Die empfehlen sich natürlich nur, wenn der Himmel für gutes Wetter sorgt. Ostern ging es zum Beispiel auf der Pfarrwies des Ortsteils Neufahrn.
„Jeder sonnt sich heut so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden.“
Der Osterspaziergang des Doktor Faust hätte auch uns nach dem Kirchgang hinausgeleitet aus „der Straßen quetschender Enge“ hinauf auf den Bierberg von Weihenstephan. Leider sind uns derzeit auch geistige Genüsse versagt. Gottlob hat Alwine dem Korb am Domportal (neben dem Opferstock) zwei dargereichte Ostereier entnommen. Als wir uns damit auf einem Steinblock in der Bürgerstadt zwischen Domberg und Bierberg ans opulente Ostermahl machen, gesellt sich ein altes Weiberl, tief über ihr Wagerl gebeugt, in gebührendem Abstand hinzu.
Die 94-jährige gepflegte Dame brummelt was von „schlecht Geh“ und „de Zähn“ durch die Maske und erzählt, dass ihr die im Heim angebotene Osterspeise nicht schmecke, weshalb sie in der Stadt „was G’scheits zum Mitnehma“ suche. Auch möcht sie schauen, wie die historische Altstadt jetzt vollends in ein Fußgängerparadies umgekrempelt wird. Baugerät umstellt das Standbild des legendären Roider Jackl. Hinter transparenter Wand an der Oberen Hauptstraße plätschert wieder das freigelegte Flüsschen Moosach durch die bald erneuerte Altstadt.
Auch eine Auferstehung, ganz profan. Corona zum Trotz.
12. April 2021
„Uuund – wieder lockern“, sagten die Trainer*innen einst nach anstrengender Leibesübung. Jetzt ist Pause. Solange der Lockdown nicht wieder gelockert ist, bleiben Turnhallen, Gymnastiksäle und Fitnessstudios verschlossen. Vergeblich hatten sich die 11 000 bayerischen Sportvereine – die 14 größten wandten sich an den Sportminister Joachim Herrmann – für den 19. April durch penible Hygiene-Vorkehrungen auf eine schrittweise Öffnung eingestellt.
Gelockert wurde aber nur ein bisschen und nur vage: Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen nun wieder zehn Personen miteinander sporteln, was für eine Fußballmannschaft schon mal nicht ausreicht. Bis zu einer Inzidenz von 100 ist der Outdoor-Sport auf zwei Erwachsene mit maximal zehn Kindern unter 14 Jahren begrenzt. Allerdings ist das nur noch in wenigen Regionen der Fall. In den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten wird die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten. Dort ist nur kontaktfreier Sport mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie einer haushaltsfremden Person (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) erlaubt, die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Hallensport sowie „Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbereich“ erlaubt die jüngste freistaatliche Regelung ausdrücklich nur unter elf Voraussetzungen: die beginnen mit „frischer Luft“ und enden mit „keine Zuschauer“.
Keine Klarheit, bemängeln Sportfunktionäre und nicht nur sie. Wie sind all diese komplizierten Bestimmungen auszulegen? Wie kann man sie kontrollieren (eine Frage, die für viele Infektionsschutzmaßnahmen gilt)? Wie könnte  man sie möglichst legal austricksen? Vielleicht, indem eine Mannschaft ihr Match vom „roten“ Landkreis weg einfach in die etwas weniger verseuchte Nachbarschaft verlegt? Und überhaupt: Warum darf man Haare und Fingernägel von erfahrenem Personal pflegen lassen, nicht aber Herz, Lunge und Muskeln?
man sie möglichst legal austricksen? Vielleicht, indem eine Mannschaft ihr Match vom „roten“ Landkreis weg einfach in die etwas weniger verseuchte Nachbarschaft verlegt? Und überhaupt: Warum darf man Haare und Fingernägel von erfahrenem Personal pflegen lassen, nicht aber Herz, Lunge und Muskeln?
Klar ist jedenfalls allen: Bewegung muss sein! Diese anhaltende Ruhigstellung – sie betrifft insbesondere Homeworker sowie Jugendliche – macht dick, träge und nicht selten krank. So ermittelte das Münchner Zentrum für Ernährungsmedizin, dass neun Prozent der unter Zehnjährigen während der ersten Ausgangsbeschränkungen deutlich zugenommen haben. Die Eingesperrten allgemein nehmen mehr Süßigkeiten, Pommes, Zuckergetränke zu sich. Dagegen hilft wenig, wenn Lokalpolitiker wie in der Schwanthaler Höhe für Ping-Pong-Platten und Bowling-Bahnen sorgen. Oder wenn der Online-Verkauf von Hometrainern, Hanteln und Schrittzählern aufblüht.
Sonderbare Bewegungsmeldungen erscheinen auch in meinem Online-Netzwerk „nebenan“. Wobei die Qigong-Schnupperstunde für Anfänger offenbar spitze ist. Eine Doris veranstaltet einen „Online Hormonyoga Refresher Workshop“. Was aber Roni den derzeit Sedierten zu bieten hat, lässt mich vollends rätseln, ihr Programm heißt „YIN YOGA & the 8 LIMBS“. Eher werde ich schlau bei den beiden Webserien, die der Bayerische Rundfunk mit Skistar Felix Neureuther ausstrahlt: „Olympia im Kinderzimmer“ und „Beweg dich schlau“. Meine Enkelin Tania tut es.
19. April 2021
Endlich mal eine erfreuliche, eine wirklich erlösende Nachricht in der leidigen Sache Corona: Ich soll, nach zweimaligem Stich, einen neuartigen, befreiend wirkenden Impfpass bekommen. Ein amtliches Zertifikat auf grünem Papier, international, auf Wunsch auch digital. Somit werde ich vielleicht bald wieder in die geliebten Tiroler Berge reisen dürfen, ohne bei der Rückfahrt von Grenzpolizisten in Quarantäne geschickt zu werden.
Wenn die bisherigen Andeutungen stimmen, dann soll dieser künftige EU-Ausweis auch noch andere, ärztlich abrufbare Daten über meine Gesundheitsgeschichte enthalten. Wie es von Krankenkassen, Gesundheitspolitikern und Patienten längst gewünscht, in Deutschland aber unter Berufung auf den Datenschutz immer noch verzögert wird. Brüssel sei Dank für den Durchbruch. Wer möchte da noch behaupten, die Euro-Bürokraten seien zu schwerfällig?
Um trotzdem sicher zu gehen, wende ich mich an meinen Gewährsmann Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar. Der Infektiologe, der jeden Tag, sogar im Urlaub, über 300 Anfragen bekommt, verweist mich auf ein Statement des Robert-Koch-Instituts vom 4. April, welches klarstellt: Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen sind von Quarantäne-Maßnahmen ebenso ausgenommen wie Personen, die in der Vergangenheit eine PCR-bestätigte und symptomatische COVID-19-Erkrankung durchgemacht haben („Genesene“) und mit einer Impfstoffdosis geimpft sind.
Zu bedauern sind nun die vielen Millionen Mitbürger, die wohl noch auf ihren Impftermin warten müssen. Ihnen hilft nur, was sie schon seit März 2020 zu üben gewohnt sind: Geduld. Immerhin hat der Einsatz von etwa 1200 Münchner Hausärzten das Impftempo verdoppelt, obwohl auch diese Aktion zunächst wieder an zögerlichem Nachschub von Ampullen litt.
 Jene aber, die sich der Covid-19-Impfung entgegen aller Wissenschaft und Aufklärung stur verweigern, mögen dann halt allein mit ihrem Freiheitsbewusstsein – oder mit ihrem Hass auf Andersgläubige – zurechtkommen. Dass sich zunehmend Rechtsextreme mit „Querdenkern“ und diesen Neinsagern verbünden, lässt sich unschwer erkennen. Ich gestehe, dass ich denen im Fall einer Infektion wenig Empathie darbringen und eher ein „Selber schuld“ zurufen würde. Beispielsweise den anonymen Impfgegnern, die unsere liebe Uschi Glas mit bösen Mails bombardierten, nur, weil sie bei der Impfwerbung mitgemacht hat.
Jene aber, die sich der Covid-19-Impfung entgegen aller Wissenschaft und Aufklärung stur verweigern, mögen dann halt allein mit ihrem Freiheitsbewusstsein – oder mit ihrem Hass auf Andersgläubige – zurechtkommen. Dass sich zunehmend Rechtsextreme mit „Querdenkern“ und diesen Neinsagern verbünden, lässt sich unschwer erkennen. Ich gestehe, dass ich denen im Fall einer Infektion wenig Empathie darbringen und eher ein „Selber schuld“ zurufen würde. Beispielsweise den anonymen Impfgegnern, die unsere liebe Uschi Glas mit bösen Mails bombardierten, nur, weil sie bei der Impfwerbung mitgemacht hat.
Die groß angelegte Impfwerbung erinnert mich übrigens an eine ähnliche Aktion. Sie zielte auf die Poliomyelitis, bekannter als spinale Kinderlähmung, weil das Virus vorwiegend Drei- bis Achtjährige durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion befallen hat. Mein Schulfreund Franz litt sehr daran. Ihm half es nicht mehr, dass der Amerikaner Jonas Salk 1955 einen ersten, oralen Impfstoff entwickelte. Bald las und hörte man überall den Aufruf: „Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam.“ Schon binnen eines Jahres war diese Viruskrankheit weltweit um 99 Prozent zurückgegangen. Nur in Afghanistan und in Afrika flackert sie immer wieder auf.
26. April 2021
Neben der Bildungsnot von Schulkindern ist es vielleicht die schlimmste Folge der Corona-Krise: die Flucht in Alkohol, Medikamente und Drogen. Diese hat in jüngster Zeit „eindeutig zugenommen“ – so eine Langfrist-Bilanz beim Blauen Kreuz in München. Der Sprecher dieser Suchthilfe-Organisation, Norbert Gerstlacher, nennt mir auf Anfrage am Telefon die wahrscheinlichen Ursachen. Sie lassen sich in Stichworten etwa so zusammenfassen und schlussfolgernd ergänzen:
Angst vor der unheimlichen Krankheit und allgemein vor der absolut ungewissen Zukunft.
Schon erlebter oder befürchteter Verlust des Arbeitsplatzes oder der finanziellen Existenzgrundlage, wenn Kurzarbeitergeld und Staatshilfen nicht mehr ausreichen.
Kontaktverlust wegen Heimarbeit oder geschlossener Kneipen (sogar die vom Blauen Kreuz betreuten Selbsthilfegruppen mussten teilweise zumachen).
Schließlich können familiäre Isolierung und häusliche Enge zur Belastung werden, zumal bei erzwungener Anwesenheit von Schulkindern, was immer häufiger zu Konflikten, ja Gewaltausbrüchen führt.
Insgesamt ist das eine fatale Entwicklung. Diese psychosozialen Folgen der Krise sind der breiten Öffentlichkeit noch zu wenig bewusst. Sie treffen besonders die ohnedies schon unterversorgten Bevölkerungsgruppen, etwa  Migrant*innen. Sie verschont aber – gerade bei anhaltender Dauer – auch nicht die Mittelklasse, etwa selbständige Gewerbetreibende und Kulturschaffende, denen die Einnahmen weggebrochen sind. In solcher Bedrängnis werden immer mehr Betroffene zur Flucht in den Alkohol getrieben.
Migrant*innen. Sie verschont aber – gerade bei anhaltender Dauer – auch nicht die Mittelklasse, etwa selbständige Gewerbetreibende und Kulturschaffende, denen die Einnahmen weggebrochen sind. In solcher Bedrängnis werden immer mehr Betroffene zur Flucht in den Alkohol getrieben.
Ohne soziale Dienste und Einrichtungen würde unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren, meint der bayerische Caritasdirektor Prälat Bernhard Piendl. „Unsere Mitarbeitenden arbeiten seit Monaten am Limit, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern.“ Als Sprecher der Freien Wohlfahrtspflege, deren Mitglieder 75 Prozent aller sozialen Dienste im Land abdecken, fügt Piendl mahnend hinzu: „So wie im letzten Jahr Schutzschirme für die Wirtschaft gespannt wurden, braucht es Schutzschirme für Menschen, die besonders unter den Folgen der
Pandemie leiden.“
3. Mai 2021
Genau 200 Schul- und Vorschulkinder – mehr waren polizeilich verboten - blockierten unter dem Schutz von Eltern und Polizisten genau eine Stunde lang den Münchner Altstadtring, während gegenüber in der Staatskanzlei der Ministerrat das Neueste zum Thema Infektionsschutz beriet. Mit selbstgemalten Transparenten, Jazz und Reden protestierten die Jungbürger gegen die „bayerische Extrawurst“, die ihnen und ihren Lehrer*innen nun schon seit Monaten ein stressiges Homeschooling bei niedrigeren Inzidenzen als in der übrigen Bundesrepublik aufnötigt. Ihre Forderung: „Ich will in die Schule.“
Blaue Kreidekreise auf der sonst so belebten Fahrbahn sollten für die gebotenen Abstände sorgen, Supervorsichtig empfahl der „Urbanaut“ Benjamin David, der die außergewöhnliche Aktion zusammen mit einer kinderreichen Mutter blitzartig organisiert und ordentlich angemeldet hatte, beim Betätigen von Trillerpfeifen lieber doch die Maske  anzubehalten. Man weiß ja nicht, wie weit die gefährlichen, von Blasmusikern ausgestoßenen Aerosole schweben. Dann ließ David sein jüngstes Söhnlein ein selbstgeschriebenes Liedlein ins Mikro singen. Die Landesmütter und -väter ließen sich trotzdem nicht blicken.
anzubehalten. Man weiß ja nicht, wie weit die gefährlichen, von Blasmusikern ausgestoßenen Aerosole schweben. Dann ließ David sein jüngstes Söhnlein ein selbstgeschriebenes Liedlein ins Mikro singen. Die Landesmütter und -väter ließen sich trotzdem nicht blicken.
Natürlich ließ sich Markus der Harte auch durch den Heidenlärm dieses Kinderkreuzzugs nicht erweichen. Immerhin aber konnten sich die jüngsten Staatsbürger eben mal ein Bild davon machen, wie Demokratie funktioniert. Sie erlebten gewissermaßen eine Lektion in Sachen Demonstration. Oder gar Nachwuchsschulung für die Generation „Friday“?
Überhaupt war die vergangene Münchner Woche, in die ja auch der 1. Mai fiel, voller den je von Demos, Aufmärschen, Kundgebungen, Kunstlieferungen und dergleichen pandemischen Gegenmaßnahmen. Auch die beschäftigungslosen Kneipenwirte steigen bitter klagend auf die Barrikaden; sie haben ihre Schanigärten, eine nette gastronomische Corona-Neuheit, längst wieder hergerichtet und fühlen sich vergessen.
Der Frust frisst sich weiter durch die frühlingsgrüne Isarstadt. Nur die ganz Anderen, die dummen Hasser, haben ihre zentrale Großveranstaltung nach Weimar verlegt. Sie verwechseln da wohl etwas: Sie halten Weimar für die klassische Stadt der Dichter und Querdenker.
10. Mai 2021
Kunst statt Karussells und ein Testzelt statt der Festzelte – so wird es aussehen auf der Theresienwiese. Erstaunlich, wie schnell und fast klaglos wir Münchner die abermalige Absage des Oktoberfests hingenommen haben, zumal dessen Verantwortungsträger sich soeben von einem Namensklau seitens Abu Dhabi konfrontiert sehen und wieder mal über weltweiten Urheberschutz nachdenken. Klar, man ist inzwischen durch die anhaltende Pandemie an Verzicht auf Liebgewordenes gewöhnt. Außerdem haben kreative Leute andere, sinnvolle Nutzungen anstelle der Traditions-Wiesn gefunden. Die Vorbereitungen konnte ich bei einem Rundgang zwischen den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Theresienwiese beobachten.
„Kunst im Quadrat“ heißt eine zur Zeit entstehende Bühne. Umzäunt wie die „Oide Wiesn“, mit Kassen und hygienischen Anlagen ausgestattet. Ähnlich wie im vorigen Jahr soll hier ein buntes Programm geboten werden, live  oder notfalls virtuell: Konzerte, Theater, Workshops, Diskussionen, Film und mehr. Über Initiativen einzelner Künstler*innen und Gruppen kann sich der Verband der Münchner Kulturveranstalter nicht beklagen. Er wartet nur noch auf Zuschusszusagen der Stadt und der drei Bezirksausschüsse, die sich die Theresienwiese teilen.
oder notfalls virtuell: Konzerte, Theater, Workshops, Diskussionen, Film und mehr. Über Initiativen einzelner Künstler*innen und Gruppen kann sich der Verband der Münchner Kulturveranstalter nicht beklagen. Er wartet nur noch auf Zuschusszusagen der Stadt und der drei Bezirksausschüsse, die sich die Theresienwiese teilen.
Wie und wann auch immer die rückläufigen Inzidenzwerte nun die Kulturwelt wiederbeleben werden – längst hat sich, nachdem die Lage nicht nur von den Leidtragenden hinreichend bejammert wurde, eine völlig neue Szene entwickelt. Streaming war gestern, umständlich, langweilig. Das verwöhnte Kulturpublikum will zurück zum Lebendigen, zur Live-Performance. Das haben ein paar kluge Köpfe erkannt und umgesetzt, indem sie ungewöhnliche Open-Air-Plätze aufrüsteten.
Roland Hefter ist ein Beispiel. Der Volksmusiker und Münchner SPD-Stadtrat hatte schon vor einem Jahr Kollegen und Wiesn-Macher*innen unter die Bavaria postiert, um sie die erste Absage des Volksfestes mit einem elegischen, aber trotzigen Lied besingen zu lassen. Jetzt, am 1. Mai, tingelte er mit seinen Songs und seiner Gitarre durch 60 Seniorenheime. Oder Mirca Lotz. Die Kuratorin hat den hauptsächlich Frauen ansprechenden Verein „Innen-Außen-Raum“ gegründet und einen Kulturabend im Prinzregentenbad veranstaltet. Auch Gotteshäuser beider Konfessionen wurden zu Bühnen die die Welt bedeuten.
Der unermüdliche Benjamin David, Erfinder der „Isarlust“ und der „Urbanauten“, feierte in jüngst auf dem Wittelsbacher Platz seinen hundertsten „Kulturlieferdienst“. Im Corona-Jahr konnte er die Stadt gewinnen, bestimmte Plätze von der Polizei autofrei zu halten, damit dort Künstler*innen auftreten konnten. Ein bisschen lebenswichtige Eigenwerbung und ein paar Euro waren allemal drin. Als Bühne diente ein LKW, der bisher gratis verliehen wurde, jetzt aber 1500 Euro im Monat kostet. Unklar, ob dafür das Spendenaufkommen ausreicht, denn auch die Techniker müssen entlohnt werden.
Wohl am erfolgreichsten kontert der Münchner Promoter Till Hofmann die Pandemie. Seine Initiativen helfen den Künstlern und bereiten vielen Menschen Freude. Hofmann hat sich von vornherein nicht abfinden wollen mit dem Lockdown seiner Kleinkunstbühnen in Schwabing und Passau. Schnell konnte er den Innenhof des Deutschen Museums für Auftritte arbeitsloser Promis gewinnen. Es läuft dort bald wieder auf Hochtouren, trotz der etwas kühlen Atmosphäre. Inzwischen erteilte die staatliche Schlösserverwaltung dem erfahrenen Impresario Aufführungsrechte im Englischen Garten. Und in Niederaltaich an der Donau darf er die Klosterwiese bespielen.
Bayerns Staatsregierung spielt jetzt auch mit. Sie möchte wohl den oft gehörten Vorwurf, die Kultur zu vernachlässigen, nicht länger auf sich sitzen lassen. Dieses zeigen die neuesten Lockerungsübungen. Kunstminister Bernd Sibler will viele Tausend Euro für den kommenden Sommer springen lassen. Und sein Chef Markus Söder hat, als gäbe es nicht schon Kampfparolen genug, auch dafür einen eingängigen Titel gefunden: „Bayern spielt“. Die neue Kulturfreiheit steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass die AHA-Regeln eingehalten werden. Denn das böse Virus hat noch lange nicht ausgespielt.
17. Mai 2021
„Ein Land sperrt wieder auf“. „Gegenoffensive an der Corona-Front“. „Schleswig-Holstein startet Tourismus neu“. So oder ähnlich klangen Schlagzeilen, die mich in den Norden der Republik lockten. Offenbar wollte MP Daniel Günther seinem Amts- und Unionsbruder Markus Söder jetzt mal zuvorkommen mit einem einsamen Beschluss; mehrmals sprach er von „Vorreiterrolle“. Erstmals liftete ein Bundesland den strengen Lockdown, öffnete Hotels und Gaststätten für den Tourismus. Ein gewagtes Experiment – trotz der niedrigsten Inzidenzwerte in Deutschland. Ob und wie das nun funktioniert, wollte ich eine Woche lang zwischen Hamburg und Flensburg testen.
Das große Seebad Eckernförde mit seinen knapp 3000 Unterkünften war zusammen mit der Schleiregion seit dem 19. April eine von vier Modellregionen. Was hieß das? In der City, auf der Strandpromenade und in den Shops mussten weiterhin Schutzmasken getragen und Abstände gewahrt werden. Im Hotel wurde weiterhin ein Negativtest verlangt, alle 48 Stunden neu. Restaurants waren, wie schon 2020, nur einer begrenzten Zahl von Gästen  zugänglich, Kontaktformulare waren auszufüllen. Die meisten Küchen blieben kalt. Frei zugänglich war – Jubel – die Außengastronomie; bei anhaltendem „Schietwetter“ blieben die Plätze jedoch ebenso leer wie Kinos, Konzertsäle, Meerwasserbad, Strandkörbe. Geschäfte durften nur mit Schnelltestnachweis betreten werden. Kurz: im Norden nichts Neues. Oder: Kein Durchbruch ohne Disziplin. Oder: Eine Flucht an die Förde hätte es eigentlich nicht gebraucht.
zugänglich, Kontaktformulare waren auszufüllen. Die meisten Küchen blieben kalt. Frei zugänglich war – Jubel – die Außengastronomie; bei anhaltendem „Schietwetter“ blieben die Plätze jedoch ebenso leer wie Kinos, Konzertsäle, Meerwasserbad, Strandkörbe. Geschäfte durften nur mit Schnelltestnachweis betreten werden. Kurz: im Norden nichts Neues. Oder: Kein Durchbruch ohne Disziplin. Oder: Eine Flucht an die Förde hätte es eigentlich nicht gebraucht.
Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, ist trotzdem zufrieden mit dem Pilotprojekt. In den vergangenen vier Wochen wurden mehr Gäste verbucht als im gleichen Zeitraum vor dem Ausbruch der Seuche. Die zur Verfügung stehenden Betten waren zu 70 bis 89 Prozent ausgelastet. Erfolg verspricht sich Borgmann allein schon von der anhaltenden Werbewirkung. Das Land an Förde und Schlei hat sich durch diese Aktion bis weit in den deutschen Süden bekannt gemacht. „Die Seeluft hier ist unbezahlbar“, schwärmte eine aus Garmisch-Partenkirchen angereiste Frau, die vor dem Info-Container geduldig in der Schlange stand. Auch die wissenschaftliche Begleitung hat ein recht positives Ergebnis gebracht: Die Inzidenzkurve ist vom ohnehin niedrigen Stand um die 70 auf unter 50 gefallen.
Am Montag lief das Projekt Modellregion aus. Schleswig-Holstein lockert jetzt landesweit die Regeln. So streng wie zum Beispiel in Bayern waren sie schon bisher nicht, wie uns bei unserer Kreuz- und-Quer-Bahnreise zwischen den Meeren auffiel. Erinnerungen in Mürwik, wo ich im Dezember 1944 als 16-jähriger Seekadett militärisch gedrillt wurde. Eine alte Dame erzählt uns beim Spazieren mit Hund und Rollator am Hafen neben der wuchtigen und immer noch wichtigen Schule der Bundesmarine, warum sie aus München hierher gezogen ist. Leider verkehren die Fähren nach Dänemark derzeit nicht; damals hatte man uns Kadetten je ein Geldstück gegeben, für das wir drüben in Sonderburg lang vermisste Schlagsahne bekamen.
In Husum, Theodor Storms „Graue Stadt am Meer“, hockten die Menschen fröhlich trinkend, masken- und abstandslos am Kai. Ähnlich „frei“ war die benachbarte, ungemein reizvolle Holländergründung Friedrichstadt. Mir fällt ein Refrain von Erich Kästner ein, bezogen auf ein Münchner Kabarett: „Die große Freiheit ist es nicht geworden, die kleine – vielleicht.“
Apropos: Die Große Freiheit, die durch einen Käutner-Film bekannte Amüsiermeile in St. Pauli, ist vorerst ebenso trist wie etwa die schöne neue Speicherstadt und überhaupt die ganze Weltstadt Hamburg. Im überdimensionalen InterCity Hotel sind wir beiden, mit Arbeitsnachweis ausgestattet, die einzigen Gäste. Zum Billigpreis erwartet uns natürlich null Service. Tourismus findet hierorts wohl noch eine Weile nicht statt. Unten indes traben mehr oder weniger maskierte Jogger durch den im Regen prächtig blühenden Park Planten und Blomen. Alles sehr eigenartig. Aber was ist schon nicht eigenartig in diesem Krieg gegen einen unsichtbaren Feind?
25. Mai 2021
Was sind das eigentlich für Typen, die sich Querdenker nennen, die ganze Hundertschaften der vollbeschäftigten Polizei auf Trab bringen, die Medien momentan aber etwas weniger bewegen? Sind es schlichte Spinner, ideologische Strategen, überkluge Köpfe, vermeintliche Weltverbesserer, notorische Neinsager, selbsternannte Philosophen oder Quacksalber, die eine harmlose Grippe namens Covid 19 durch Handauflegen heilen? Keinesfalls verwechseln sollte man sie mit Quereinsteigern, wie sie neuerdings die etwas angegraute Fraktion der SPD im Münchner Stadtrat auffrischen sollen. Auch nicht mit dem Typus Linksdenker, den der Berliner Kurt Tucholsky einst einem „seltenen, traurigen, unirdischen, maßlos lustigen Komiker“, nämlich unserem Karl Valentin, freundlichst zugeschrieben hat.
Komisch, dass selbst die Suchmaschine nur eine eher wohlfeile Erklärung liefert: Querdenker sei „jemand, der eigenständig und originell denkt und dessen Ideen und Ansichten oft nicht verstanden oder akzeptiert werden“. Statt einer genaueren Interpretation stößt man im Netz auf eine Querdenker United GmbH. Diese Community mit weltweit 500 000 Anhängern will – wie unzählige andere Gruppen - „auf friedlichem Wege einen Beitrag zum Austausch und zur Potenzialentfaltung der Menschen leisten“. Sie distanziert sich denn auch von „Veranstaltungen, die in populistischer Absicht und im Gleichschritt mit fragwürdigen politischen Agitatoren aus allgemeinem Unmut und Frustration Stimmung gegen die Gesellschaft machen“.
In meinem eigenen Kopf-Computer indes werde ich besser fündig. Oft genug hatte ich ja in meinem früheren Leben als Münchner Korrespondent außerbayerischer Zeitungen mit Typen zu tun, denen man durchaus das Etikett  „Querdenker“ aufpappen könnte. Der erste dieser Art war vielleicht ein Physiker namens Groll, der das Perpetuum mobile errechnet haben wollte und dies so präzise nachwies, dass 1951 sogar der Spiegel meinen Bericht brachte. Der „Wunderdoktor“ Bruno Gröning (links im Bild im Interview mit mir), den die Abendzeitung von Herford nach München gelotst hat, gilt noch heute als das „Phänomen“ schlechthin. Schlag nach im Netz.
„Querdenker“ aufpappen könnte. Der erste dieser Art war vielleicht ein Physiker namens Groll, der das Perpetuum mobile errechnet haben wollte und dies so präzise nachwies, dass 1951 sogar der Spiegel meinen Bericht brachte. Der „Wunderdoktor“ Bruno Gröning (links im Bild im Interview mit mir), den die Abendzeitung von Herford nach München gelotst hat, gilt noch heute als das „Phänomen“ schlechthin. Schlag nach im Netz.
So mancher jener Querköpfe der Nachkriegszeit bastelte aus seinen Gedankenspielen seine eigene Partei, erwähnt seien nur Karl Feitenhansl und Franz Schönhuber. Ein hochprozentiger Sonderling wurde gar bayerischer Staatsminister, er hieß Alfred Loritz. Ein eben solcher Typ, der fränkische Kommunarde Dieter Kunzelmann, war bei mir zuhause ein eher ungebetener Dauergast; er überhäufte mich mit seinen Schriften und seiner abstrusen Weltanschauung dermaßen, dass ich meinen Dackel in Kunzelmann umtaufte. Fazit: Kreuz-und-Querdenker aller Art scheinen im Land der Märchenkönige besonders üppig zu gedeihen.
Überhaupt nicht vorstellbar ohne Querdenker ist die Kunstgeschichte. Das Museum Villa Stuck zeigt zurzeit hervorragende Beispiele – von Josef Beuys bis Adolf Wölfli – unter dem Titel "Bis ans Ende der Welt und über den Rand".
31. Mai 2021
Während die Spekulationen mithilfe von allerlei Zahlenspielen wild um sich greifen und immer dringender gefragt wird, wann endlich weitergehende Lockerungen kommen, gehen in den noch seuchenbeladenen Städten womöglich dauerhafte Veränderungen vor sich. So bemerke ich in der Münchner City nicht nur ein Zurück zu einer gewissen Normalität, sondern auch einen Trend zur Urbanität, zu mehr städtischer Atmosphäre. Die Aufhebung der Testpflicht und die Neuöffnung von Hotels machen es des trotz schlechten Wetters möglich, dass wieder Leben dort einkehrt, wo Experten eben noch befürchtet hatten, dass viele Einzelhändler und Gaststätten vielleicht für immer zumachen müssen,
Die Gefahr, dass die Altstadt regelrecht veröden könnte, scheint aber fürs Erste gebannt. Etwa 70 000 mehr oder weniger kauflustige Stadtbewohner*innen und erste Touristen*innen sollen am Pfingstwochenende das Zentrum  überflutet haben, schätzt Wolfgang Fischer vom Verband der City-Partner. Die Läden füllen sich mit Kunden, fast so wie im Juni 1948 nach der Währungsreform. Die auf 30 Prozent oder noch tiefer gefallenen Umsätze steigen wieder. Man muss ja nicht gleich von einem Pfingstwunder sprechen.
überflutet haben, schätzt Wolfgang Fischer vom Verband der City-Partner. Die Läden füllen sich mit Kunden, fast so wie im Juni 1948 nach der Währungsreform. Die auf 30 Prozent oder noch tiefer gefallenen Umsätze steigen wieder. Man muss ja nicht gleich von einem Pfingstwunder sprechen.
Nicht zuletzt dank einer Ausdünnung des Autoverkehrs hat Münchens City neue Urbanität gewonnen. Auf einigen Fahrtrassen sind Pop-up-Radwege entstanden und zahlreiche Parkplätze haben sich in sogenannte Schanigärten verwandelt. Diese sollten eigentlich nur während der Pandemie erlaubt sein, um die Wirte ein wenig zu entschädigen. Inzwischen wurden immer mehr davon amtlich zugelassen, einige haben sich sogar schon spezialisiert. Jetzt sieht es danach aus, dass sich das ansprechende Wiener Vorbild gänzlich in München durchsetzen werde.
Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU), dem nun zwei Mal das Oktoberfest entgangen ist, will mit mehreren Organisationen demnächst einen „City-Gipfel“ einberufen, der über weitere Attraktionen zur Wiederbelebung des größten Einkaufszentrums Bayerns nachdenken soll. Man sollte allerdings nicht nur ans Einkaufen denken. Unter dem Motto „Rasten ohne Konsumzwang“ hat das städtische Baureferat auf Anregung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bisher 400 Parkbänke in der Isarstadt aufstellen lassen: die Bezirksausschüsse stehen Schlange. Somit scheint die böse Pandemie schließlich auch für ein bisschen mehr Ruhe in rastloser Stadt zu sorgen.
7. Juni 2021
Viele Mitteilungen beginnen jetzt mit dem Wörtchen „endlich“. Alles wieder offen, alles wieder gut? Folglich: allgemeine Demaskierung - wie früher auf Faschingsbällen nach Mitternacht üblich? Runter mit der lästigen Mundwindel, endlich, endlich. So sehen es anscheinend viele Mitbürger. Und schon drängen sie sich vielerorts maskenfrei, zu Hunderten, jung und alt, Frauen und Männer, meist bar jeder Vorsicht. Die so lange und so geduldig gewahrten Grundregeln der Hygiene sind offenbar weitgehend in Vergessenheit geraten. Anstand und Respekt sowieso.
Solch Verhalten könnte gefährlich werden. Es fordert Politiker ebenso heraus wie die Polizei. Beileibe nicht nur auf den berüchtigten Hotspots der Bayernmetropole, sondern auch in anderen Städten kommt es bei Routine-Kontrollen – rund 5000 waren es an den „aufgelockerten“ Wochenenden in München - zu handfester Gegenwehr von oft angetrunkenen Jugendlichen jeglichen Geschlechts. Polizist*innen müssen sich anpacken lassen. Sachliche Ermahnungen werden mit Anpöbeln oder gar Anspucken beantwortet. Flaschen werden geworfen. Eine Polizistin kam deshalb ins Krankenhaus. Klar doch, die Bars bleiben geschlossen, die Burschen sind frustriert. „Das Aggressionslevel ist deutlich gestiegen“, wird amtlich gemeldet. Ein 18-Jähriger tanzte vor dem Hauptbahnhof sogar auf dem Dach eines Streifenwagens und wurde, bis zur Festnahme, von etwa 30 jungen Leuten umjubelt.
Dabei tun diese Beamten nur ihre Pflicht, sie müssen das Infektionsschutzgesetz durchsetzen, nach wie vor, denn die Infektionen dauern an. Sie tun das ohne Gummiknüppel oder Wasserwerfer, wenn auch manchmal, vielleicht zur Abschreckung, in Hundertschaftstärke oder auch mal hoch zu Ross. Irgendwie erinnert mich das an die Schwabinger Krawalle von 1962 und auch an die Halbstarkenkrawalle von 1956, als ich junger Reporter einen Bericht mit einem gerichtlichen Zitat des Anführers einer „Jugendblase“ betitelte: „Hauts die Blauen z’amm“. Alles schon mal dagewesen.
Dieses Mal aber zielt die allgemeine polizeiliche Sicherheitsparole ganz klar auf De-Eskalation. Mit solcher Strategie beweisen sich die Männer und Frauen in den wieder blauen Uniformen durchaus als Freunde und Helfer in dieser verunsicherten Zeit – gleich wie all die zu Recht so hochgelobten Ärzte, Pfleger, Wissenschaftler, Gesundheitspolitiker und sonstigen Nothelfern jeglichen Geschlechts. Es wäre doch mal an der Zeit für ein Dankeschön.
Übrigens wird uns das Corpus Delicti, die Mund-Nasen-Maske, wahrscheinlich noch lange bleiben – und letztlich schützen. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen – so wie seit langem schon die Bewohner fernöstlicher Metropolen, um sich gegen vergleichsweise harmloser Grippewellen zu wappnen. Kein Virologe weiß, wie lange das aktuelle oder ein anderes Virus noch virulent sein wird auf diesem Planeten. Als Hinterbliebener der Kriegsgeneration sage ich mir jedenfalls: Besser diese Schutzmaske als eine Gasmaske.
Obwohl – vor einem halben Jahrhundert genau, am 25. Juni 1951, habe ich einen Zeitungsartikel veröffentlicht unter der Überschrift „Münchner klagen über Atombeschwerden“. Damals hatte die radioaktive Wolke der ersten Thermonuklearbombe, von den Amerikanern auf der Südsee-Insel Bikini gezündet, bayerischen Boden verseucht. Zehn Jahre später kam es hierzulande, nach dem Testen von noch stärkeren Atombomben, abermals zu panischen Reaktionen. Dem Bundesinnenminister Hermann Höcherl (CSU) oder seinen Beratern fiel dazu nur ein, eine Fibel herauszugeben mit dem schönen Tipp, man solle sich im Notfall auf den Boden werfen und den Kopf mit einer Aktentasche schützen. Der Lacherfolg war groß.
14. Juni 2021
Ein ebenso schlimmes wie wichtiges Stück Zeit- und Stadtgeschichte – genauer: Gesundheitsgeschichte – nähert sich schneller als gedacht seinem Ende. Sang- und klanglos gewissermaßen, wie vor genau hundert Jahren die dritte Welle der Spanischen Grippe mit ihren 50 Millionen Todesopfern. Momentan überschlagen sich jedenfalls die amtlich verfügten Lockerungen des Lockdowns, bis hin zur Aufhebung von Maskenpflicht und Alkoholverbot in der Münchner City. Die „neue Normalität“ scheint angebrochen.
Ende Juni soll auch die Bundes-Notbremse gelöst werden. Da also vorerst nicht mehr viel Neues vom dramatischen Abwehrkampf gegen den Großangriff der neuen Viren zu reflektieren ist, wäre es für mich wohl an der Zeit, mein  Corona-Tagebuch nach bald anderthalbjähriger Laufzeit einzustellen. Dies natürlich nur unter VORBEHALT – das Wort sei ganz groß geschrieben. Denn es gibt ja Experten, die zum Herbst, sollten die Sommerferien alle noch unbedingt nötige Hygiene wegschwemmen, eine vierte Welle für durchaus möglich halten. Immerhin „überwintern“ Viren bekanntlich in Wirtstieren.
Corona-Tagebuch nach bald anderthalbjähriger Laufzeit einzustellen. Dies natürlich nur unter VORBEHALT – das Wort sei ganz groß geschrieben. Denn es gibt ja Experten, die zum Herbst, sollten die Sommerferien alle noch unbedingt nötige Hygiene wegschwemmen, eine vierte Welle für durchaus möglich halten. Immerhin „überwintern“ Viren bekanntlich in Wirtstieren.
Wie bei zwei von drei Infektionen – etwa bei Pest, Pocken und Aids – handelt es sich bei Covid-19 um eine Zoonose, eine von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheit. Damit befasste Wissenschaftler sagen deren Zunahme voraus. Denn der – großenteils illegale – Handel mit wilden, auch mit exotischen Tieren blüht weltweit. Zunehmen dürften auch neuartige Erreger, denen der „Spillover“, der Sprung auf die andere Art, gelungen ist. Wuhan, wo alles begann, lässt grüßen.
Bevor ich das Tagebuch zuschlage, will ich aber noch einmal versuchen, aus meiner Münchner Sicht heraus Bilanz zu ziehen: Was hat Corona verändert in meinem unmittelbaren Umfeld? „Alles“ lautet ein Gemeinplatz. Konkreter wäre zu fragen: Was hat sich durch das „Herunterfahren unseres gesamten öffentlichen Lebens“ (Markus Söder) tatsächlich verschlechtert? Was hat sich ins Gedächtnis eingegraben? Was hat sich unter Umständen vielleicht sogar verbessert? Welche Folgerungen ergeben sich aus alledem?
Bei einer solch rückblickenden Wertung werde ich auf persönliche Erfahrungen, auf Zufälle und auf Spekulationen angewiesen sein. Auch soll unterschieden werden zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Im Fokus stehen zum Beispiel – hier bunt gemischt – das öffentliche Gesundheitswesen, Gastronomie und Ernährung, Stadt und Verkehr, Kulturbetriebe, Kino, Reisen, Shopping, soziale Ordnung, Kinderbetreuung, Schule und Beruf, Medien.
In den nächsten Tagebuch-Folgen möchte ich den Versuch unternehmen, einige dieser Problemfelder nach Soll und Haben zu bilanzieren. Anschließend könnte dieses Tagebuch eines Lebens mit der Seuche enden – oder erst mal nur unterbrochen werden. Je nach dem vom Bundesgesundheitsminister dann wieder verkündeten „Stand heute“.
21. Juni 2021
Den Versuch einer persönlichen Bilanz habe ich mir also - vielleicht - abschließend vorgenommen. Was hat uns die so gut wie auslaufende Pandemie nach eineinhalb Jahren letztlich „gebracht“? Beginnen möchte ich mit dem eigenen Gewerbe, dem Lesen und Schreiben von Zeitungstexten. Denn kein anderes Thema hat die Medien so anhaltend beherrscht wie das Thema Corona, das längst unter verschiedenen Schlüsselworten durch Zeitungsspalten und Glasfaserkabel geistert.
In unserem süddeutschen Leitmedium zum Beispiel ist das Thema, dem zeitweilig jeden Tag eine ganze Seite geopfert wurde, auf ein paar Spalten geschrumpft. Verschwunden sind die blutroten Felder auf der Deutschlandkarte; nur noch gelb und hellgrau ist diese jetzt eingefärbt. Alle Inzidenzen liegen unter dem Grenzwert, der unser aller Alltagsleben bestimmt hat. Das heißt: Der Alarm ist abgeblasen. Im Bombenkrieg hatten wir ein anderes Wort der Erlösung: „Entwarnung“ (manchmal schickte uns der Feind dann allerdings neue tödliche Flieger).
Nahezu verschwunden sind auch die immer gleichen Namen von Gesundheitspolitikern und Virologen, die ständigen Erklärer, Warner, Kommentatoren in Funk, Fernsehen, Printpresse und Sozialen Medien. Ganz verstummt sind sie aber keineswegs; noch ist ihr Rat gefragt. Zum Beispiel in Sachen Mutanten, Impfschutzdauer oder gar – Gott bewahre! – neuer, anderer Virusgefahr. Was uns die Experten bemüht verständlich mitzuteilen hatten, in Pressekonferenzen, per Podcast oder in Fernseh-Talkrunden, das hat ja oft geschreckt, aber fast immer gestimmt …
Wie hat sich nun die Pandemie in München tatsächlich entwickelt? Ein sehr knapper Rückblick: Am 28. Januar 2020 wurden erstmals bei vier Deutschen, Mitarbeitern einer Firma bei München, das neuartige Virus Sars-CoV-2 festgestellt, sie genasen im Schwabinger Krankenhaus. Am 9. März waren es 60 Fälle, alle Massenveranstaltungen wurden untersagt. Am 12. März stieg die Zahl der Infizierten im Stadtgebiet auf 313, in der Bayernkaserne wurde eilig ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Am 22. März, einem Sonntag, starb im Klinikum Großhadern der erste Covid-Kranke, ein 56-Jährtiger mit Vorerkrankung. Und fortan erreichte die Zahl der positiv getestete Münchner jeden Tag dreistellige Größen.
Heute, am 21. Juni 2021, meldet das Robert-Koch-Institut für München eine Inzidenz von 12,2. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt sieben. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es keine.
Fotos: Karl Stankiewitz, Thomas Stankiewicz, Münchner Stadtmuseum, Münchner Buchmacher im Rathaus, argum, Klinikum rechts der Isar, Tania Seifert, Angelika Kleinz, Ursula Harper/Grüne München und dpa











 Er hat schon viel erlebt. Karl Stankiewitz ist 1928 geboren und einer der ältesten aktiven Journalisten in Deutschland. Doch die Corona-Krise stellt auch den Münchner Autor vor viele neue Herausforderungen. Sein Corona-Tagebuch, das auf bayerische-staatszeitung.de regelmäßig aktualisiert wird, gibt spannende Einblicke in das Leben in München während der Corona-Krise - aus ganz persönlicher Sicht.
Er hat schon viel erlebt. Karl Stankiewitz ist 1928 geboren und einer der ältesten aktiven Journalisten in Deutschland. Doch die Corona-Krise stellt auch den Münchner Autor vor viele neue Herausforderungen. Sein Corona-Tagebuch, das auf bayerische-staatszeitung.de regelmäßig aktualisiert wird, gibt spannende Einblicke in das Leben in München während der Corona-Krise - aus ganz persönlicher Sicht. Angstniveau ist unterschiedlich,“ begründet der Anästhesist die Terminabsagen. Mein Makula-Eingriff verläuft schnell und problemlos. „Scheißgeschäft,“ schimpft dann der Taxifahrer, der mich auf den Hintersitz platziert. Sein Gewerbe wurde auf vier Standorte in der Stadt reduziert.
Angstniveau ist unterschiedlich,“ begründet der Anästhesist die Terminabsagen. Mein Makula-Eingriff verläuft schnell und problemlos. „Scheißgeschäft,“ schimpft dann der Taxifahrer, der mich auf den Hintersitz platziert. Sein Gewerbe wurde auf vier Standorte in der Stadt reduziert. freundlich. Den Geldschein nimmt er mit knappem Dank an, die festen Schuhe nicht. Sie sind zu klein. Punkt 14 Uhr wird das Tor geöffnet. Toni schiebt den Einkaufswagen mit seinem Hausrat die Treppe hoch und verschwindet im dunklen Gotteshaus. Er will sich, nach schlechter Nacht, noch ein bisschen hinlegen. Corona fürchtet er nicht.
freundlich. Den Geldschein nimmt er mit knappem Dank an, die festen Schuhe nicht. Sie sind zu klein. Punkt 14 Uhr wird das Tor geöffnet. Toni schiebt den Einkaufswagen mit seinem Hausrat die Treppe hoch und verschwindet im dunklen Gotteshaus. Er will sich, nach schlechter Nacht, noch ein bisschen hinlegen. Corona fürchtet er nicht. Geburtenziffern zu Anfang nächsten Jahres zunehmen werden? Ich suche nach einem kleinen Lichtblick im offiziellen Tagesbericht, werde aber enttäuscht. Wieder gibt es 293 Neuinfizierte in München, die Gesamtzahl steigt somit auf 2080 Fälle.
Geburtenziffern zu Anfang nächsten Jahres zunehmen werden? Ich suche nach einem kleinen Lichtblick im offiziellen Tagesbericht, werde aber enttäuscht. Wieder gibt es 293 Neuinfizierte in München, die Gesamtzahl steigt somit auf 2080 Fälle.  ziemlich genau ein Viertel.
ziemlich genau ein Viertel. bemerkte. Deshalb lenken wir unsere Schritte in den totenstillen Waldfriedhof. Wir finden das Grab von Frank Wedekind. Bei seiner Bestattung im Kriegsjahr 1918 - als die Spanische Grippe über München herfiel - hatte unser Skandaldichter letztmals einen Skandal verursacht; Im Beisein berühmter Trauergäste wie der Mann-Brüder und des Jungdichters Brecht setzte der junge Autor Lautensack zum Sprung ins offene Grab an.
bemerkte. Deshalb lenken wir unsere Schritte in den totenstillen Waldfriedhof. Wir finden das Grab von Frank Wedekind. Bei seiner Bestattung im Kriegsjahr 1918 - als die Spanische Grippe über München herfiel - hatte unser Skandaldichter letztmals einen Skandal verursacht; Im Beisein berühmter Trauergäste wie der Mann-Brüder und des Jungdichters Brecht setzte der junge Autor Lautensack zum Sprung ins offene Grab an.  ergriffen werden. Offenbar werden vom Polizeipräsidium und vom Innenministerium fast stündlich neue Parolen ausgegeben, die sich in Details unterscheiden und teilweise sogar widersprechen.
ergriffen werden. Offenbar werden vom Polizeipräsidium und vom Innenministerium fast stündlich neue Parolen ausgegeben, die sich in Details unterscheiden und teilweise sogar widersprechen. höherwertige Ausführungen und natürlich der für das medizinische Personal gefertigte Nasen-Mund-Schutz Marke FFP, der keinerlei Viren durchlassen soll. Egal, Masken sind Mode geworden. Und diesbezüglich marschiert München allemal in der Avantgarde.
höherwertige Ausführungen und natürlich der für das medizinische Personal gefertigte Nasen-Mund-Schutz Marke FFP, der keinerlei Viren durchlassen soll. Egal, Masken sind Mode geworden. Und diesbezüglich marschiert München allemal in der Avantgarde. im Biergarten sämtliche Tische und Stühle weggeräumt sind. Mehr als ein halbes Jahrhundert verbindet mich mit dieset Bierburg. 1944 hatten Militärärzte uns Oberschüler hier auf Kriegstauglichkeit gemustert. Bald nach Kriegsende hatten im selben noch intakten Festsaal die US-Besatzer erste Popkonzerte für die Münchner Jugend arrangiert. Das war uns wie ein letzter Akt der Befreiung nach langer Knebelung erschienen.
im Biergarten sämtliche Tische und Stühle weggeräumt sind. Mehr als ein halbes Jahrhundert verbindet mich mit dieset Bierburg. 1944 hatten Militärärzte uns Oberschüler hier auf Kriegstauglichkeit gemustert. Bald nach Kriegsende hatten im selben noch intakten Festsaal die US-Besatzer erste Popkonzerte für die Münchner Jugend arrangiert. Das war uns wie ein letzter Akt der Befreiung nach langer Knebelung erschienen. wieder die Öffnung. Wenn auch nur in Teilbereichen. Zeitgleich mit Großkaufhäusern, Golfen, Segeln und Reiten. Nach einer Zwangspause von fünfzig Tagen startet am Wochenende die Abteilung Musik und Theater. Allerdings nur mit einem ersten kleinen öffentlicher Auftritt. Denn einen offziellen Öffnungstermin gibt es für diese beiden Bereiche noch nicht.
wieder die Öffnung. Wenn auch nur in Teilbereichen. Zeitgleich mit Großkaufhäusern, Golfen, Segeln und Reiten. Nach einer Zwangspause von fünfzig Tagen startet am Wochenende die Abteilung Musik und Theater. Allerdings nur mit einem ersten kleinen öffentlicher Auftritt. Denn einen offziellen Öffnungstermin gibt es für diese beiden Bereiche noch nicht. Protestplakaten gegen "Notstandsgesetze" und die Abschaffung von Bürgerrechten auf Dauer. Frauen sind deutlich in der Überzahl. Eine, die sich als Ossi bekennt, erinnert an die Hongkong-Grippe vor 20 Jahren mit etwa 40 000 Toten in beiden Deutschlands. Damals hätten Politiker und Medien auf Panikmache verzichtet, im Gegensatz zu heute, da Depressionen und Existenzängste in noch nicht abzusehendem Maße systematisch erzeugt würden. Ähnlich bedenkenswert dann Argumente weiterer Redner.
Protestplakaten gegen "Notstandsgesetze" und die Abschaffung von Bürgerrechten auf Dauer. Frauen sind deutlich in der Überzahl. Eine, die sich als Ossi bekennt, erinnert an die Hongkong-Grippe vor 20 Jahren mit etwa 40 000 Toten in beiden Deutschlands. Damals hätten Politiker und Medien auf Panikmache verzichtet, im Gegensatz zu heute, da Depressionen und Existenzängste in noch nicht abzusehendem Maße systematisch erzeugt würden. Ähnlich bedenkenswert dann Argumente weiterer Redner.  man Schlange stehen, um einen der reduzierten Plätze unter den Kastanien zugewiesen zu bekommen. Auch darf man die mitgebrachte Breze am Tisch nicht verzehren, und zu essen gibt’s sonst weit und breit nichts. Darob vergeht mir erst mal der Appetit.
man Schlange stehen, um einen der reduzierten Plätze unter den Kastanien zugewiesen zu bekommen. Auch darf man die mitgebrachte Breze am Tisch nicht verzehren, und zu essen gibt’s sonst weit und breit nichts. Darob vergeht mir erst mal der Appetit.  und perfekter Programme veranstaltet und per Livestream bisweilen mit Spendenbitte oder Bezahlschranke in die Wohnzimmer gesendet. Dafür bedarf jeweils der Anmeldung, die von der Landeszentrale für neue Medien stets unbürokratisch und kostenfrei genehmigt wird. Digitale Angebote dieser Art, meint Münchens Kulturreferent Anton Biebl, könnten künftig die Kulturszene bereichern.
und perfekter Programme veranstaltet und per Livestream bisweilen mit Spendenbitte oder Bezahlschranke in die Wohnzimmer gesendet. Dafür bedarf jeweils der Anmeldung, die von der Landeszentrale für neue Medien stets unbürokratisch und kostenfrei genehmigt wird. Digitale Angebote dieser Art, meint Münchens Kulturreferent Anton Biebl, könnten künftig die Kulturszene bereichern. Statue der Julia. Carmen Finkenzeller von „Stattreisen“ verteilt Schokoherzerl und macht gleich auf eine zeitbedingte Veränderung aufmerksam. Der Bronzebusen der schönen Braut des Romeo ist deutlich nachgedunkelt und nicht mehr so goldig poliert wie früher. Ein Indiz für das mehrwöchige Ausbleiben von Touristen, die – so die Mär - durch Berühren just dieser Brust ihr Liebesleben aufbessern konnten.
Statue der Julia. Carmen Finkenzeller von „Stattreisen“ verteilt Schokoherzerl und macht gleich auf eine zeitbedingte Veränderung aufmerksam. Der Bronzebusen der schönen Braut des Romeo ist deutlich nachgedunkelt und nicht mehr so goldig poliert wie früher. Ein Indiz für das mehrwöchige Ausbleiben von Touristen, die – so die Mär - durch Berühren just dieser Brust ihr Liebesleben aufbessern konnten. festen Standorten in der Pinakothek der Moderne sprechen Kunstvermittler jeweils zehn Minuten lang mit einer Person, einem Paar oder einer Familie über ausgestellte Werke: ihre Wirkung, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten. Ein vorläufiger Ersatz für die noch nicht wieder möglichen Führungen. Die Warteschlangen am Haupteingang sind trotzdem nicht zu vermeiden.
festen Standorten in der Pinakothek der Moderne sprechen Kunstvermittler jeweils zehn Minuten lang mit einer Person, einem Paar oder einer Familie über ausgestellte Werke: ihre Wirkung, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten. Ein vorläufiger Ersatz für die noch nicht wieder möglichen Führungen. Die Warteschlangen am Haupteingang sind trotzdem nicht zu vermeiden. einen Corona-Hut Nicki Marquart mit einer Spannweite von 1,5 Metern. Gesammelt wurden aber vor allem Dokumente, die Bürgerinnen und Bürger, junge und alte, zum leidvollen Thema des Jahres eingeliefert haben. Da dominieren natürlich die oft komischen, liebevoll angefertigten Mundschutzmasken sowie die Fotos von der großen, ungewohnten Leere: auf Autobahnen, im Straßenbild, in Biergärten, auf dem Flughafen, im zunächst ausverkauftem Supermarkt. Polizisten mit Motorrädern kontrollieren ein einsames Pärchen im Englischen Garten. „Stop! Ausgangssperre. Tötliches Virus,“ plakatierte eine Steffi etwas fehlerhaft vor ihrer Behausung. Superoptimistisch verkündet jemand: „Ois werd guad.“
einen Corona-Hut Nicki Marquart mit einer Spannweite von 1,5 Metern. Gesammelt wurden aber vor allem Dokumente, die Bürgerinnen und Bürger, junge und alte, zum leidvollen Thema des Jahres eingeliefert haben. Da dominieren natürlich die oft komischen, liebevoll angefertigten Mundschutzmasken sowie die Fotos von der großen, ungewohnten Leere: auf Autobahnen, im Straßenbild, in Biergärten, auf dem Flughafen, im zunächst ausverkauftem Supermarkt. Polizisten mit Motorrädern kontrollieren ein einsames Pärchen im Englischen Garten. „Stop! Ausgangssperre. Tötliches Virus,“ plakatierte eine Steffi etwas fehlerhaft vor ihrer Behausung. Superoptimistisch verkündet jemand: „Ois werd guad.“  als Reporter der Abendzeitung jahrelang kritisch beobachtet hatte. In Krisenzeiten „wärmte man sich an Wahrsagern und Wunderheilern“, schrieb neulich der Historiker Norbert Frey in der Süddeutschen Zeitung und erwähnte den „Stanniolkugeln verteilenden Schreiner“.
als Reporter der Abendzeitung jahrelang kritisch beobachtet hatte. In Krisenzeiten „wärmte man sich an Wahrsagern und Wunderheilern“, schrieb neulich der Historiker Norbert Frey in der Süddeutschen Zeitung und erwähnte den „Stanniolkugeln verteilenden Schreiner“. Isar zwischen Reichenbach- und Corneliusbrücke, auf dem Gärtnerplatz und rund um den Wedekindplatz, wo Ende Juni 1962 aus heiterem Himmel die „Schwabinger Krawalle“ begonnen hatten. Damals griff die Polizei sehr hart zu. Das wagt sie heute nicht mehr. Die strategischen Möglichkeiten, das Völkchen zur gebotenen Distanz untereinander und zum Vermummen anzuhalten, sind begrenzt. Ebenso ratlos wie die Ordnungshüter, stöhnen die jungen Leute, die sich zu lange schon eingeengt fühlen: „Wo sollen wir denn sonst hin?“
Isar zwischen Reichenbach- und Corneliusbrücke, auf dem Gärtnerplatz und rund um den Wedekindplatz, wo Ende Juni 1962 aus heiterem Himmel die „Schwabinger Krawalle“ begonnen hatten. Damals griff die Polizei sehr hart zu. Das wagt sie heute nicht mehr. Die strategischen Möglichkeiten, das Völkchen zur gebotenen Distanz untereinander und zum Vermummen anzuhalten, sind begrenzt. Ebenso ratlos wie die Ordnungshüter, stöhnen die jungen Leute, die sich zu lange schon eingeengt fühlen: „Wo sollen wir denn sonst hin?“ humorlosen Nazis nicht verhindern konnten, über die Mach- und Schmachtwerke der UFA, mit denen uns die Kriegshetzer einlullten, danach mit Western, Krimis, Komödien, Katastrophenthriller. Bevorzugt: historische, literarische und biografische Stoffe sowie der Neue Deutsche Film. Etliche Stars und namhafte Filmmacher, das Schwabinger Junggenie Rainer Werner Fassbinder ebenso wie den Pasinger Porno-Produzenten Alois Brummer oder den französischen Naturforscher und -filmer Cousteau, konnte ich Interviewen.
humorlosen Nazis nicht verhindern konnten, über die Mach- und Schmachtwerke der UFA, mit denen uns die Kriegshetzer einlullten, danach mit Western, Krimis, Komödien, Katastrophenthriller. Bevorzugt: historische, literarische und biografische Stoffe sowie der Neue Deutsche Film. Etliche Stars und namhafte Filmmacher, das Schwabinger Junggenie Rainer Werner Fassbinder ebenso wie den Pasinger Porno-Produzenten Alois Brummer oder den französischen Naturforscher und -filmer Cousteau, konnte ich Interviewen. nichts, es gibt jetzt Ersatz. Auf der so leeren Wiesn und einigen anderen schönen Stadtarenen und Höfen sollen von Ende Juli bis zum Ende der Sommerferien lauter kleine, alternative, kostengünstige Volksfeste improvisiert werden. Der Stadtrat und die darbenden Schausteller haben dem Projekt, das sich nun doch etwas verzögert hat, freudig bis begeistert zugestimmt.
nichts, es gibt jetzt Ersatz. Auf der so leeren Wiesn und einigen anderen schönen Stadtarenen und Höfen sollen von Ende Juli bis zum Ende der Sommerferien lauter kleine, alternative, kostengünstige Volksfeste improvisiert werden. Der Stadtrat und die darbenden Schausteller haben dem Projekt, das sich nun doch etwas verzögert hat, freudig bis begeistert zugestimmt. Führung vorbereitet). Herr Müller wiegte den Kopf: Immer noch diese Probleme, Abstand halten und so ... Nicht wenige der 180 Mitglieder, überwiegend Rentner, haben ihn wissen lassen, dass sie immer noch - mehr oder weniger - Angst vor derartigen Zusammenkünften haben.
Führung vorbereitet). Herr Müller wiegte den Kopf: Immer noch diese Probleme, Abstand halten und so ... Nicht wenige der 180 Mitglieder, überwiegend Rentner, haben ihn wissen lassen, dass sie immer noch - mehr oder weniger - Angst vor derartigen Zusammenkünften haben. n München ganze Hundertschaften ausrücken, um Massen von Maskenverweigerern, vorgeblichen Grundrechte-Schützern, Krakeelern und als solche erkennbaren Provokateure, oft mit rechtsextremen Schreiern durchsetzt, bei elementarer Missachtung der Hygiene-Regeln aufzuklären, an den „Hotspots“ einigermaßen zu bändigen oder notfalls zu zerstreuen. Künftig sollen uniformierte Ordnungshüter auch noch Auslandsheimkehrer zum Corona-Test zwingen.
n München ganze Hundertschaften ausrücken, um Massen von Maskenverweigerern, vorgeblichen Grundrechte-Schützern, Krakeelern und als solche erkennbaren Provokateure, oft mit rechtsextremen Schreiern durchsetzt, bei elementarer Missachtung der Hygiene-Regeln aufzuklären, an den „Hotspots“ einigermaßen zu bändigen oder notfalls zu zerstreuen. Künftig sollen uniformierte Ordnungshüter auch noch Auslandsheimkehrer zum Corona-Test zwingen. stöhnen besonders wegen der Hitze im Gesicht, fügen sich aber ins Unvermeidliche, ältere Schüler natürlich eher als die jüngeren. Und eine Lehrerin klagt, sie müsse sich bemühen, fortan mit der Maske viel deutlicher und langsamer zu sprechen - und des gleichen ihren Schülern aufzuerlegen.
stöhnen besonders wegen der Hitze im Gesicht, fügen sich aber ins Unvermeidliche, ältere Schüler natürlich eher als die jüngeren. Und eine Lehrerin klagt, sie müsse sich bemühen, fortan mit der Maske viel deutlicher und langsamer zu sprechen - und des gleichen ihren Schülern aufzuerlegen. Klorollen ebenso wie das Maskentreiben, die Verschwörungsspinner ebenso wie die beschwerliche Kommunikation von Balkon zu Balkon („Immer auf den Abstand achten“).
Klorollen ebenso wie das Maskentreiben, die Verschwörungsspinner ebenso wie die beschwerliche Kommunikation von Balkon zu Balkon („Immer auf den Abstand achten“). Verantwortlichen als Teufelszeug aus der DDR. Da war natürlich Ideologie im Spiel. Mehrmals berichtete ich über Forschungen des Münchner Psychologie-Professors Heinz-Rolf Lückert über Möglichkeit und Notwendigkeit frühkindlicher intellektueller Bildung. Derlei Thesen stießen auf Widerspruch.
Verantwortlichen als Teufelszeug aus der DDR. Da war natürlich Ideologie im Spiel. Mehrmals berichtete ich über Forschungen des Münchner Psychologie-Professors Heinz-Rolf Lückert über Möglichkeit und Notwendigkeit frühkindlicher intellektueller Bildung. Derlei Thesen stießen auf Widerspruch. damals andere Entwicklungen zu Buche: Rezessionen in Nachbarländern, der Abzug von NATO-Truppen und ganz besonders die – im Ausland mit Sorge beobachteten – Umtriebe von Neonazis.
damals andere Entwicklungen zu Buche: Rezessionen in Nachbarländern, der Abzug von NATO-Truppen und ganz besonders die – im Ausland mit Sorge beobachteten – Umtriebe von Neonazis. Brunnen plätscherte ungehemmt weiter. Langsam aber hob sich Corona-Söders Eiserner Vorhang. Erst öffneten wieder der Italiener Pepenero und der Inder Sitar, beide reklamierten noch einige der eh ungeliebten Parkplätze als Freischrankflächen hinzu.
Brunnen plätscherte ungehemmt weiter. Langsam aber hob sich Corona-Söders Eiserner Vorhang. Erst öffneten wieder der Italiener Pepenero und der Inder Sitar, beide reklamierten noch einige der eh ungeliebten Parkplätze als Freischrankflächen hinzu. Pseudo-Gaudi sollen wir verzichten, sondern auch auf andere Gewohnheiten. Zum Beispiel auf das öffentliche „Zammahocken“ von mehr als fünf „Kumpeln“ (Hubert Aiwanger). Oder auf die eine oder andere Herbstreise ins Ausland. Denn die Bundesregierung hat nicht weniger als 14 EU-Länder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen.
Pseudo-Gaudi sollen wir verzichten, sondern auch auf andere Gewohnheiten. Zum Beispiel auf das öffentliche „Zammahocken“ von mehr als fünf „Kumpeln“ (Hubert Aiwanger). Oder auf die eine oder andere Herbstreise ins Ausland. Denn die Bundesregierung hat nicht weniger als 14 EU-Länder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen. den Kameras präsentierte. Derweil warnte der deutsche Gesundheitsminister radikal und ausnahmslos vor Auslandsreisen in den Herbst- und Winterferien. Und unsere oberste Krisenmanagerin nannte das, was auf uns alle zukommt, in ihrer einfachen, aber eindringlichen Sprache „eine schwierige Zeit“. Grippezeit, Virenzeit, Coronazeit nächste Folge. Und höchste Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
den Kameras präsentierte. Derweil warnte der deutsche Gesundheitsminister radikal und ausnahmslos vor Auslandsreisen in den Herbst- und Winterferien. Und unsere oberste Krisenmanagerin nannte das, was auf uns alle zukommt, in ihrer einfachen, aber eindringlichen Sprache „eine schwierige Zeit“. Grippezeit, Virenzeit, Coronazeit nächste Folge. Und höchste Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Therapeutikum Remdesivir, das auch dem US-Präsidenten Trump verabreicht wurde, in Studien gezeigt werden, dass die Aufenthaltsdauer um 31 Prozent verkürzt werden konnte. Drittens hat sich das Vorsichtsbewusstsein der deutschen Bevölkerung deutlich verstärkt.“
Therapeutikum Remdesivir, das auch dem US-Präsidenten Trump verabreicht wurde, in Studien gezeigt werden, dass die Aufenthaltsdauer um 31 Prozent verkürzt werden konnte. Drittens hat sich das Vorsichtsbewusstsein der deutschen Bevölkerung deutlich verstärkt.“  Holzschwert anlegte. In der Kita, vier Tage später, muss sich der Vater beim Eintritt maskieren, Lions drei Betreuer müssen es fortwährend. Der Bub trägt eine Windjacke überm Pulli. Es kann nämlich kalt werden, alle 20 Minuten muss mindestens drei Minuten gelüftet werden, wie auch von der Bundeskanzlerin höchst persönlich empfohlen. Es gefällt Lion recht gut in diesem Tagesheim fern der Eltern. „Wenn die Vorschule rum ist“, plaudert er, „dann dürfen wir spielen.“ Begeistert erzählt er von verschiedenen Spielen, bis hin zur Kissenschlacht.
Holzschwert anlegte. In der Kita, vier Tage später, muss sich der Vater beim Eintritt maskieren, Lions drei Betreuer müssen es fortwährend. Der Bub trägt eine Windjacke überm Pulli. Es kann nämlich kalt werden, alle 20 Minuten muss mindestens drei Minuten gelüftet werden, wie auch von der Bundeskanzlerin höchst persönlich empfohlen. Es gefällt Lion recht gut in diesem Tagesheim fern der Eltern. „Wenn die Vorschule rum ist“, plaudert er, „dann dürfen wir spielen.“ Begeistert erzählt er von verschiedenen Spielen, bis hin zur Kissenschlacht. 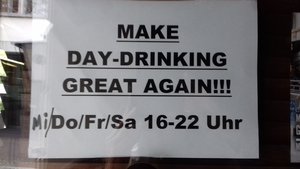 Verzweiflung, als Joe, ein junger Barkeeper im Lehel die halblustige Parole plakatierte: „Make day drinking great again“. Andere Kneipiers hatten schon ganz zugemacht: zu viel Hygiene-Aufwand, zu hohes Bußgeld, zu wenig Gäste.
Verzweiflung, als Joe, ein junger Barkeeper im Lehel die halblustige Parole plakatierte: „Make day drinking great again“. Andere Kneipiers hatten schon ganz zugemacht: zu viel Hygiene-Aufwand, zu hohes Bußgeld, zu wenig Gäste. schwarze Wände mit wenigen Knallfarben und Kacheln aus den sanierten Kammerspielen, raffinierte, mit Ökostrom betriebene Licht- und Ton-Spiele, ein Teppichboden, der beim Tanzen vibriert.
schwarze Wände mit wenigen Knallfarben und Kacheln aus den sanierten Kammerspielen, raffinierte, mit Ökostrom betriebene Licht- und Ton-Spiele, ein Teppichboden, der beim Tanzen vibriert. Erschöpfung, nicht aber Fieber oder Husten. Höchste Zeit für einen Coronavirus-Test. Meine Hausärztin nahm den Abstrich vom Fenster aus vor, um keine Patienten in der Praxis zu gefährden, ich stehe dabei draußen auf der Liebigstraße. Der Befund: zum Glück negativ.
Erschöpfung, nicht aber Fieber oder Husten. Höchste Zeit für einen Coronavirus-Test. Meine Hausärztin nahm den Abstrich vom Fenster aus vor, um keine Patienten in der Praxis zu gefährden, ich stehe dabei draußen auf der Liebigstraße. Der Befund: zum Glück negativ. 250 Mitarbeitern) in Aussicht stellt. Voraussetzung ist, dass interessierte Betriebe „in eine existenzbedrohende Lage gekommen sind oder massive Liquiditätsprobleme haben“. Der Engpass muss nach dem 11. März 2020 eingetreten sein.
250 Mitarbeitern) in Aussicht stellt. Voraussetzung ist, dass interessierte Betriebe „in eine existenzbedrohende Lage gekommen sind oder massive Liquiditätsprobleme haben“. Der Engpass muss nach dem 11. März 2020 eingetreten sein. Maximiliankirche im Münchner Glockenbachviertel. Bis zum 19. Januar noch werden in diesem „Notre Dame an der Isar“ morgens und abends Messfeiern zelebriert, wie sie froher, schöner, inniger kaum sein könnten.
Maximiliankirche im Münchner Glockenbachviertel. Bis zum 19. Januar noch werden in diesem „Notre Dame an der Isar“ morgens und abends Messfeiern zelebriert, wie sie froher, schöner, inniger kaum sein könnten. werden. So drängen Fußgänger und Radler gern auf den neuen, elegant über die Bahngleise geschwungenen Arnulfsteg, der somit die Funktion der Hackerbrücke übernimmt, wo Massen von jungen Leuten, mit Flaschen in der Hand auf verschnörkeltem Geländer hockend, gern den Sonnenuntergang erwartet haben. Andere Abendbummler lockt das Werksviertel, obwohl es noch eine riesige Baustelle ist.
werden. So drängen Fußgänger und Radler gern auf den neuen, elegant über die Bahngleise geschwungenen Arnulfsteg, der somit die Funktion der Hackerbrücke übernimmt, wo Massen von jungen Leuten, mit Flaschen in der Hand auf verschnörkeltem Geländer hockend, gern den Sonnenuntergang erwartet haben. Andere Abendbummler lockt das Werksviertel, obwohl es noch eine riesige Baustelle ist. aggressive Aufschriften („Verpisst euch“), markige Aussprüche von Mandatsträgern („dahoam is aa schee“), Sperre oder Verteuerung von Parkplätzen und ähnliche eigenmächtige Maßnahmen immer mehr vergraulten. Münchner, so meldet der Münchner Merkur, seien geradezu „verhasst“ im Alpenvorland. Mancherorts mache man sich Sorgen um die „Tourismusgesinnung“, stellte die Süddeutsche Zeitung fest
aggressive Aufschriften („Verpisst euch“), markige Aussprüche von Mandatsträgern („dahoam is aa schee“), Sperre oder Verteuerung von Parkplätzen und ähnliche eigenmächtige Maßnahmen immer mehr vergraulten. Münchner, so meldet der Münchner Merkur, seien geradezu „verhasst“ im Alpenvorland. Mancherorts mache man sich Sorgen um die „Tourismusgesinnung“, stellte die Süddeutsche Zeitung fest




















Kommentare (6)