Nach Friedrich Hilble – bis 1937 Leiter des Münchner Wohlfahrtsamts – ist eine Straße im Stadtteil Neuhausen/Nymphenburg benannt. Doch bald könnte es die Hilblestraße nicht mehr geben. Denn Hilble soll als Antisemit willfähriger Vollstrecker von Nazi-Gesetzen gewesen sein. Der Stadtrat lässt die Rolle der Sozialverwaltung im Nationalsozialismus jetzt prüfen.
Es sollen verdiente Personen sein, nach denen in München Straßen benannt werden. So will es die Straßennamen- und Hausnummernsatzung von 1988. Die Hilblestraße im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg ist nach dem berufsmäßigen Stadtrat und Leiter des Münchner Wohlfahrtsamtes benannt. Friedrich Hilbles Verdienst, so die offizielle Begründung: „Auf seine Initiative hin wurde das Altersheim St. Joseph gebaut.“
Doch der Hilblestraße könnte es bald wie der Meiser-Straße ergehen: Diese wurde umbenannt, als der Antisemitismus des evangelischen Landesbischofs aus den 1920er Jahren zum Thema öffentlicher Debatte wurde. Auch Hilble wird Antisemitismus vorgeworfen – und die willfährige Vollstreckung von Nazi-Gesetzen.
Der Verein Geschichtswerkstatt Neuhausen macht regelmäßig mit Publikationen auf sich aufmerksam . Zuletzt mit Von der „Aiblingerstraße“ bis „Zum Künstlerhof“, wo die Straßennamen von Neuhausen-Nymphenburg erläutert werden. Darunter ist auch die Hilblestraße, die erst 1956 entstand, als die Kriegs-Ruinen der ehemaligen Kaserne weggeräumt waren. „Ein verdienter Leiter des städtischen Wohlfahrts- und Jugendamtes“ sei Hilble (1881 bis 1937) gewesen, heißt es in der damaligen offiziellen Begründung zur Straßenbenennung. Im Buch des Vereins liest sich das ganz anders: „Rund 10 Jahre nach der NS-Herrschaft eine Straße nach einem Mann zu benennen, der das System der Nazis und damit den verordneten Antisemitismus stützte und diesen in die Tat umsetzte, ist eigentlich unverständlich.“ Der Verein fordert nun die Stadt auf, diesen „unhaltbaren Zustand“ zu ändern.
"Arbeitsscheue" Fürsorgeempfänger kamen nach Dachau
Und nicht nur die Geschichtswerkstatt zeichnet inzwischen ein ganz neues Bild von Hilble. Obwohl kein NS-Parteimitglied, habe er, ohne dazu gezwungen zu sein, die „restriktive Behandlung der Juden, denen er die Sozialhilfe verweigerte“ verschärft und die im NS-Jargon sogenannten „Asozialen“ in Arbeits- und Konzentrationslager verbringen lassen. Die Beschäftigung mit der Person Hilbles eröffnet den Blick auf ein bislang weitgehend unterbelichtetes Thema der NS-Verfolgung: Die Mithilfe der städtischen Wohlfahrtsbürokratie bei der Durchsetzung der NS-Ideologie und des Terror- und Vernichtungssystems der Nationalsozialisten.
An der Person Hilbles lassen sich die Kontinuitäten bei der Ausgrenzung und Verfolgung von Bevölkerungsgruppen in der Weimarer Republik und der Hitler-Zeit festmachen. Der Nationalsozialismus kam aus der Mitte der Gesellschaft. Der Unterschied zu kleinbürgerlichen Stammtisch-Parolen aber bestand darin, dass die Nazis damit tödlichen Ernst machten. Die Autorin Claudia Brunner macht in ihrer Studie Bettler, Schwindler, Psychopathen deutlich, dass es bereits vor 1933 eine systematische Ausgrenzung von „asozialen“ und „minderwertigen“ Personen gegeben habe. 1924 wurde durch eine Reichsverordnung die Möglichkeit geschaffen, für „Arbeitsscheue“ und „unwirtschaftliche Personen“ die Sozialleistungen auf das lebensnotwendige Existenzminimum zu beschränken und eine Pflichtarbeit zuzuweisen – Hartz IV hat lange zurückreichende Wurzeln. Und 1931 beklagte bei einer offiziellen Feier der Präsident des Bayerischen Statistischen Landesamts eine „Entedelung des Volkskörpers“, weil statt der Eliten die Proletarier die meisten Kinder bekämen – Sarrazin ist also beileibe keine neue Erscheinung.
Die Nationalsozialisten griffen diese vorhandenen Tendenzen auf und verschärften sie: Ab 1934 konnten „arbeitsscheue“ Fürsorgeempfänger in das Konzentrationslager Dachau zwangseingewiesen werden. 1938 wurde der „Volkskörper“ in einer reichsweiten Razzia von Bettlern und Obdachlosen gesäubert, ab 1942 „Asoziale“ nach Auschwitz deportiert. „Asozial“ war dabei ein weiter, im Grunde undefinierter Begriff, der Landstreicher und Alkoholkranke, politisch Andersdenkende und Prostituierte, „Störenfriede“ und „Frauenzimmer“ umfassen konnte. Mithin all jene, die durch das jeweils vor Ort existierende angebliche „gesunde Volksempfinden“ ausgesondert wurden. In Bayern bestand bereits seit 1926 das „Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz“, das zum Beispiel die Einweisung von nichtsesshaften Arbeitslosen in Arbeitshäuser durch die Polizei vorsah, unabhängig von Gerichten.
Uneingeschränkte Loyalität gegenüber einem unmenschlichen Regime
Von diesem Gesetz machten die „bayerischen Behörden vor 1933 häufigen, nach 1933 geradezu exzessiven Gebrauch“, so Brunner. Wohlfahrtsamt und Polizei arbeiteten dabei Hand in Hand. „Die Eingewiesenen sind im polizeilichen Sammelschubverkehr an die Polizeidirektion München zu verschuben, von wo ihre Überstellung in das Lager Dachau durch die Bayerische Politische Polizei in den für die Schutzhäftlinge vorgesehenen Kraftwagen übernommen wird“, heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums an die Regierung von Oberbayern.
Brunner charakterisiert Hilble als „Musterbeispiel eines pflichtgetreuen peniblen deutschen Beamten“, dessen „Verdienste“ in der „unbarmherzigen Durchsetzung nationalsozialistischen Gedankenguts“ und der „uneingeschränkten Loyalität gegenüber einem unmenschlichen Regime“ bestanden. Bereits vor 1933 hatte der Leiter des Münchner Wohlfahrtamts sich als heftiger Befürworter der Pflichtarbeit für Wohlfahrtserwerbslose und von Kürzungen im Sozialbereich hervorgetan. Nach 1933 führte er einen systematischen Kampf gegen angeblich „Arbeitsscheue“ und ließ diese „erbarmungslos“ verfolgen. So wurde das Münchner Wohlfahrtsamt bayernweit Spitzenreiter bei der Einweisung in das KZ Dachau. Hilble sei eine „noch tiefere Verstrickung in den Nationalsozialismus“ nur durch seinen frühen Tod durch ein Gallenleiden erspart geblieben, so Brunner.
Mittlerweile hat der Bezirksausschuss von Neuhausen-Nymphenburg auf Anregung der Geschichtswerkstatt beim Münchner Stadtrat eine Überprüfung der Namensgebung der Hilblestraße beantragt. Der Kommunalausschuss entschied, diesbezüglich erst die Ergebnisse einer vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Studie abzuwarten, die die Rolle der städtischen Sozialverwaltung im Nationalsozialismus untersucht. Wann diese abgeschlossen sein wird, ist allerdings noch unklar. (Rudolf Stumberger)










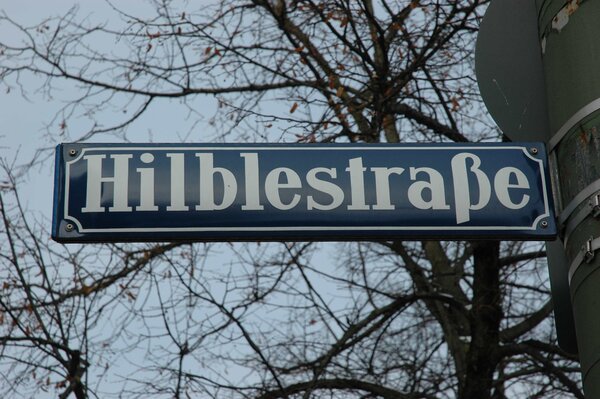





Kommentare (0)
Es sind noch keine Kommentare vorhanden!