Lassen Sie sich von den folgenden beiden Sätzen nicht abschrecken, sie sind Anlass einer größeren Debatte: Eine Geothermieanlage fördert durch einen Bohrkanal heißes Wasser an die Erdoberfläche. Der Kanal besteht aus zwei Abschnitten, die im Modell vereinfacht durch die Strecken [AP] und [PQ] mit den Punkten A(0|0|0), P(0|0|1) und Q(1|1|3,5) beschrieben werden.
Das ist Teil einer Aufgabe aus dem Mathematik-Abitur 2019 - jener Prüfung, die in mehreren Bundesländern Debatten über Notenschlüssel und Schwierigkeitsgrade ausgelöst hat. Bis hin zu Online-Petitionen mit Zehntausenden Unterstützern. Doch hinter der Diskussion steckt mehr: die Frage, wie zeitgemäß der Mathe-Unterricht ist.
Mathe ist nicht nur unbeliebt, das Fach macht vielen auch Angst
"Unsere Schülerinnen und Schüler berichten fast ausnahmslos von Angstgefühlen im Matheunterricht", sagt die Pädagogische Leiterin der Berliner Nachhilfeschule Lernwerk, Swantje Goldbach. Angst, nichts zu verstehen oder zu versagen. Der Landesschülersprecher der Gymnasien in Bayern, Joshua Grasmüller, Klasse 11, bestätigt die Einschätzung: "In letzter Zeit hat der Angstcharakter zugenommen."
Mathe gilt als unbeliebt, Grasmüller spricht gar von einem Hassfach. Manch einer kokettiert mit seinem Unwissen. Da werde aus einer Alles-egal-Haltung Angst, weil die Prüfungen nicht einfacher würden, sagt Grasmüller. Der sächsische Landesschülersprecher Noah Wehn, vor wenigen Tagen die letzten Abiprüfungen absolviert, meint: Mathematik sei nach wie vor ein Fach, das besondere Ansprüche habe, wofür mehr zu Hause getan werde als etwa für Deutsch. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Matthias Weingärtner, noch mitten im Abistress, stellt fest: "Mathematik ist der Schlüssel zur Welt." Kopf- und Bruchrechnen seien elementar. "Das muss jeder beherrschen."
Es ist immer wieder am Matheunterricht gedoktert worden. Die Quintessenz klingt im Gespräch mit Experten aus der Praxis ein bisschen nach: gut gemeint, aber nicht besonders erfolgreich.
Kopfrechnen geriet eher in den Hintergrund
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Algorithmen, Statistik, Zinsrechnung, Informatik seien wichtiger geworden, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. "Dafür sind andere Gebiete eher in den Hintergrund getreten, etwa das Kopfrechnen in der Grund-, Unter- und Mittelstufe, Binomialverteilung, Simulationen, Differentialgleichungen in der Oberstufe." In einigen Ländern wurden Leistungskurse abgeschafft, andernorts schrumpfte der Umfang des Unterrichts im Zuge der G8-Reformen. Nun fehle Zeit zum Vertiefen.
Früher stand der Umgang mit "symbolischen, fachlichen und technischen Elementen der Mathematik" im Vordergrund. In neuen Bildungsstandards der Länder sind laut bayerischem Kultusministerium Kompetenzen wie Kommunizieren und Argumentieren verankert. "Ziel ist es, sowohl im Unterricht als auch in Prüfungen den Schülerinnen und Schülern beide Facetten der Mathematik - Mathematik als eigene Wissenschaft auf der einen Seite, angewandte Mathematik auf der anderen - aufzuzeigen."
Heraus kommen neue Aufgabenformate, wie Meidinger sagt. Mathematische Fragestellungen sollen "in konkrete Lebenszusammenhänge" eingebettet werden. Ein Beispiel ist besagte Geothermie-Aufgabe, in der Theorie mehr oder weniger elegant in ein Praxisproblem gepresst wurde.
Gerade in Mathe ist die Leistungs-Kluft groß
Einigen Studien zufolge erzielen Schüler bessere Leistungen, wenn sie die praktische Relevanz der Aufgaben erkennen, sagte Meidinger. Doch das habe unerwünschte Nebeneffekte: "Oft klingen die Fragestellungen sehr konstruiert." Das lenke vom mathematischen Kern ab. Schwächere Schüler würden gleich zu Prüfungsbeginn verunsichert, bekämen nicht selten einen Blackout. Solche mit Sprachdefiziten hätten Nachteile.
Sachsens Landesschülersprecher Wehn verweist auf Online-Medien zum Lernen: "Kanäle wie "The Simple Maths" oder der "DorFuchs" auf Youtube schaffen es ganz gut, den Stoff mit ausführlichen und gut strukturierten Beispielen zu veranschaulichen, dabei auch durchaus Humor besitzen oder mittels einprägender Melodien einen Ohrwurm für beispielsweise die pq-Formel (bei quadratischen Funktionen) generieren." Immer öfter bauten Lehrer das in ihren Unterricht ein.
"Gerade in der Mathematik ist die Kluft zwischen Kindern mit Verständnisproblemen und mathematischen "Durchblickern" besonders groß", sagt Meidinger. Da müssten Lehrer besonders darauf achten, dass schwächere Schüler ihre Verständnisprobleme und Fragen äußerten, ohne beschämt zu werden. Positiv vor allem für Mädchen sei, dass zunehmend Lehrerinnen das Fach Mathematik unterrichteten.
Bezüge schaffen: Wie schnell schmilzt ein Gletscher?
Mathe-Professor Reinhard Oldenburg von der Uni Augsburg sagt, beim Abspecken der Lehrpläne seien Themen aus Algebra und Geometrie wie Kegelschnitte weggefallen. "Diesen Prozess könnte man weitertreiben. Man sollte neu bewerten, welchen Bildungswert beispielsweise der Kathetensatz hat oder die Flächenberechnung unter irgendwelchen Funktionsgraphen." Das findet auch Weingärtner. Angesichts der Klimademonstrationen schlägt er vor, zu berechnen, wie schnell ein Gletscher schmilzt. "Das hätte einen deutlich näheren Bezug als das exponentielle Wachstum von Seerosen in einem Teich."
Zudem sollte Unterricht besser individuellen Werdegang und Interessen der Schüler berücksichtigen, so Weingärtner. Oldenburg sagt, moderne Bildung sollte Fragen etwa nach kürzesten Wegen (Navigationssysteme) und mathematische Grundlagen von Bild- und Videoverarbeitung berücksichtigen. So lernten Schüler, mit digitalen Werkzeugen umzugehen, die in ihrer Lebenswelt wichtige Rollen spielten.
Relevant sei zudem Computerwissen auf Basis schulüblicher Mathematik- und Naturwissenschaftskenntnisse, sagt Oldenburg. Schüler könnten dann selbst prüfen, ob die Erhöhung der CO2-Konzentration auf den Einfluss des Menschen oder doch eher auf Vulkane zurückzuführen ist. "Wenn Schule Digitalisierung dafür nutzen würden, dann wären nicht nur die Freitage "for future", sondern die ganze Woche."
(Marco Krefting, dpa)










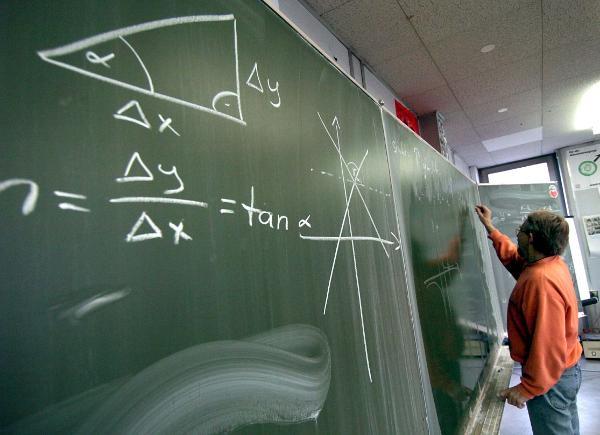





Kommentare (0)
Es sind noch keine Kommentare vorhanden!