Eigentlich ist die Sozialpolitik Sache der EU-Mitgliedstaaten. Die EU kann nur in Teilbereichen der Sozialpolitik ergänzend tätig werden. Aber sie hat es erreicht, soziale Mindeststandards für alle etwa 500 Millionen Menschen in der EU zu setzen. Alle 28 EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten sich im November 2017 auf dem sogenannten „EU-Sozialgipfel“ im schwedischen Göteburg feierlich dazu bekannt. Verbindlich sind sie allerdings nicht. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und die bayerische Staatsregierung befürchten aber, dass damit ein Weg in die Vergemeinschaftung der Sozialsysteme beschritten wird. Die Sozialmodelle, die in jedem EU-Land jahrhundertelang gewachsen seien, könne man nicht in eine Form pressen. Das sagte Barbara Schretter, die Leiterin der Vertretung des Freistaates in Brüssel stellvertretend für die bayerische Staatsregierung einleitend auf einer dortigen Veranstaltung zum Thema Sozialunion, zu dem die vbw Vertreter der EU-Kommission und des EU-Parlaments geladen hatte.
Die vbw lehnt die meisten der 20 Initiativen ab
Es ist nicht das erste Mal, dass die vbw das Thema in Brüssel zur Diskussion brachte. Vor einem Jahr, im März 2017, ging es lediglich um die Pläne der EU-Kommission, die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) um eine „Säule sozialer Rechte“ zu ergänzen (Staatszeitung berichtete). Zu der Zeit wusste man noch nicht, was die EU-Behörde vorschlagen würde, denn das tat sie erst im April 2017. Aber was sie vorschlug, wurde schon im Oktober 2017 von den 28 EU-Arbeitsministern einstimmig befürwortet und schließlich am 17. November von EU-Parlament, EU-Rat und EU-Kommission in Göteborg feierlich proklamiert. Die bayerische Staatsregierung und die vbw haben daran einiges auszusetzen.
Die vbw sieht die Europäische Säule sozialer Rechte kritisch und lehnt die meisten der 20 Initiativen ab. Die Säule würde die EU nicht stärken, sondern „die gegenwärtige Krise der EU verschärfen, heißt es in einer 20-seitigen Stellungnahme der vbw.
Ivor Parvanov, Leiter der Zentralabteilung Sozial- und Gesellschaftspolitik bei der vbw: „Wir wollen ein starkes Bayern, ein starkes Deutschland in einem starken Europa.“ Die Säule sozialer Rechte sei der falsche Weg. Das Problem sei nicht zu geringe soziale Sicherheit in der EU, sondern zu geringe Wettbewerbsfähigkeit. Und überdies überschreite die EU ihre Kompetenzen. Sozialpolitik sei und bleibe Sache der Mitgliedstaaten.
Kein Widerspruch
Manuela Geleng von der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EU-Kommission und dort Leiterin der Unterabteilung für Soziales widersprach: „Ich sehe keinen Widerspruch zur Wirtschaftspolitik. Wenn es Mitgliedstaaten schlecht geht, importieren sie weniger, verschulden sich“. Die Portugiesin meinte, dass durch Sozialpolitik die Inlandsnachfrage gestärkt, der Einkommenskreislauf in Gang gesetzt und das Wirtschaftswachstum stimuliert werde. „Wirtschaftspolitik ohne Sozialpolitik geht nicht. Wir müssen eine Aufwärtskompetenz haben.“
Die EU-Kommission beruft sich gerade auf die soziale Marktwirtschaft, die ein Bayer, nämlich Ludwig Erhard (1897-1977) in Deutschland eingeführt hatte: „Auftrag und Anliegen der EU im sozialen Bereich ist es, das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern (Artikel 3 EU-Vertrag) und auf die nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Schutz hinzuwirken“, heißt es im Bericht der EU-Kommission zum sozialen Besitzstand der EU vom März 2016. Die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 habe gezeigt, dass die Sozialausgaben – und insbesondere die Leistungen bei Arbeitslosigkeit - als automatischer Stabilisator fungieren, der zur Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft beitrage. Um eine wirksame makroökonomische Stabilisierung zu erreichen, müsse die Effektivität der Sozialausgaben und der sozialen Unterstützung für die Bevölkerung im Erwerbsalter gewährleistet werden.
Maria João Rodrigues , portugiesische Europaabgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion (S & D) sowie Berichterstatterin zu dem Thema soziale Säule, pflichtete ihrer Landsmännin von der EU-Kommission bei. Sie berichtete vom wirtschaftlichen Comeback ihres Landes und führte das auf die Sozialpolitik der dortigen Minderheitsregierung unter Sozialistenchef António Costa zurück.
Der erhöhte den Mindestlohn, nahm Gehaltskürzungen und Sondersteuern aus den Krisenjahren zurück und führte die 35-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst wieder ein. „Wir konnten die Löhne erhöhen, hatten dadurch ein höheres Wirtschaftswachstum und konnten so unser öffentliches Haushaltsdefizit reduzieren. Das ist das Gegenteil von dem, was man einen Teufelskreis nennt.“
Geld soll aus einem Solidaritätsfonds kommen
Für eine Angleichung der Wirtschafts- und Sozialsysteme in der Eurozone ist der französische Staatspräsident Emannuel Macron. Er fordert sogar mehr als die EU-Kommission, nämlich einen Haushalt für die Eurozone und einen gemeinsamen Minister, der diesen steuert. Macron will auch bei Mindestlöhnen und Sozialversicherungsstandards mehr Konvergenz. Das Geld dafür soll aus einem Solidaritätsfonds kommen, der den am wenigsten reichen Ländern zu Gute kommt. Der Europaabgeordnete Thomas Mann (CDU), der im Ausschuss des EU-Parlaments für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sitzt, fand Macrons Vorschläge utopisch: „Der kann nur gut reden“.
Manuela Geleng von der Sozialabteilung der EU-Kommission und die Europaabgeordnete Maria João Rodrigues führten noch ein zweites Argument für europäische Sozialpolitik ein: Die Digititalisierung. Sie kremple die Arbeitswelt um und unterhöhle die Sozialsysteme. Die Arbeitswelt 4.0 eröffne zwar neue Geschäftsmodelle, wie die amerikanischen Unternehmen Google, Amazon und der Taxidienst Uber demonstrierten, könne aber auch zu digitalem Tagelöhnertum führen. Die Digitalisierung verwische die Trennlinie zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen, Waren und Dienstleistungen, Konsumenten und Produzenten. Dieses neue Phänomen könne eben nicht national, sondern nur europäisch geregelt werden.
„Die Digitalisierung beschäftigt uns auch“, entgegnete Ivor Parvanov von der vbw. „Das muss aber nicht europäisch geklärt werden.“ Die vbw kritisiert die zu breite Definition des Begriffs „Arbeitnehmer“ durch die EU-Kommission. Sie erfasse auch Selbstständige, die in Deutschland nicht verpflichtet sind, Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. Die vbw ist gegen mehr Nachweispflichten für Arbeitgeber, weil sie für kleine Unternehmen schädlich sind.
Nachweisrichtlinie ändern
Eine Initiative der EU-Kommission im Rahmen der sozialen Säule ist die Änderung der sogenannten Nachweisrichtlinie, in Deutschland und Österreich auch abwertend „Dienstzettel-Richtlinie“ genannt. Dabei geht es um Informationen, die Arbeitgeber den Arbeitnehmern zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses mitzuteilen haben. In der alten Richtlinie ging es nur um Arbeitsentgelt, Arbeitszeit etc. Die neue sieht weiteren Informationspflichten und folgende inhaltliche Mindestrechte für Arbeitnehmer vor:
• Höchstdauer der Probezeit
• Grundsätzliches Recht auf Nebentätigkeit
• Verbindliche Festlegungen zu Beginn der Beschäftigung bei variabler Arbeitszeit
• Recht nach sechs Monaten eine andere Beschäftigungsform zu verlangen (zum Beispiel Stammarbeitsplatz beim Entleiher, unbefristet, Vollzeit)
• Recht auf kostenlose Fortbildung, wenn diese verpflichtend ist.
Die EU-Kommission rechtfertigt die Änderung der Richtlinie aus dem Jahre 1991, zu der sie im Dezember 2017 einen Änderungsvorschlag gemacht hat, damit dass sich die Arbeitswelt erheblich verändert habe und es mehr und mehr „atypische“ Formen der Beschäftigung gebe, begünstigt durch die Digitalisierung.
Der vbw-Hauptgeschäftsführer, Bertram Brossardt, machte deutlich, dass die vbw die Revision der Nachweisrichtlinie ablehne. Das Vorhaben stelle einen weiteren, abzulehnenden Schritt in Richtung „Sozial-Union“ dar. Gerade kleine Unternehmen ohne eigene Personalabteilung könnten durch die sehr umfangreichen Informationspflichten überfordert werden.
Zwar ist die soziale Säule für alle Mitgliedstaaten unverbindlich (es gibt keine Sanktionen) und Gesetzesvorschläge wie die Änderung der Nachweis-Richtlinie bedürfen noch ihrer Zustimmung. Aber Bayern hat Angst, dass die EU-Kommission die soziale Dimension der EU mit Unterstützung des französischen Präsidenten Macron und vielleicht der neuen italienischen Regierung weiter vorantreiben kann. Bayern will keine Sozialunion; jeder Mitgliedstaat soll weiterhin seine eigene Sozialpolitik machen können.
Auf der anderen Seite ist es verständlich, das die EU-Kommission den „Laden“ (die EU) zusammenhalten will, indem sie den EU-Binnenmarkt sozialer gestaltet. Die einen halten das für den richtigen Weg, Bayern für den falschen.
(Rainer Lütkehus)










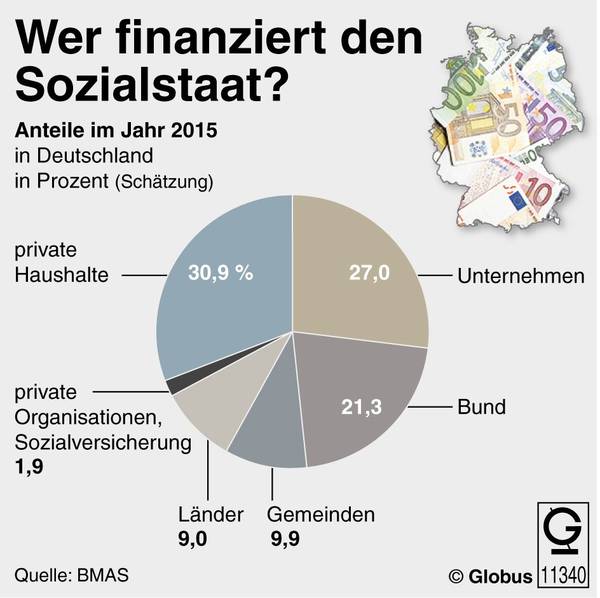





Kommentare (0)
Es sind noch keine Kommentare vorhanden!